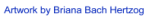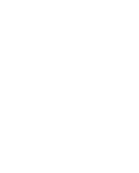Bachstädte und Bachorte: Gräfenroda, Thüringen
1 Warum ist Gräfenroda einer der Bachorte?
Gräfenroda. Eine der Bachstädte? Ist Gräfenroda überhaupt eine Stadt? Sicherlich nicht. Das ist Gräfenroda auch vor dem Zusammenschluss mit anderen Gemeinden zum Ort Geratal nie gewesen. Nicht mit 3.300 Einwohnern und einer Gartenzwergmanufaktur in der Mitte. Ist es denn dann wenigstens einer der Bachorte? Das schon viel, viel eher. Oder besser: das ganz sicher.
Der zweite bedeutende Bachbiograf Philipp Spitta wies bereits vor 200 Jahren in seinem Werk auf diesen Ort hin. Etwas nebulös. Und er erwähnte Hans. Einen Hans vor „unserem“ Veit. Nun, wenn Sie sich nicht sonderlich für die Bach-Genealogie interessieren, dann klicken Sie am besten später weg. Und fangen Sie mit Ihrer Zeit etwas Besseres an. Denn nach meiner Präsentation von Gräfenroda tauchen wir – auf dieser Seite – etwas mehr in die Tiefe der Streitereien und der vielen Missverständnisse um einen Besuch Johann Sebastian Bachs in diesem Ort ein: Es sind die Ansichten und Ungereimtheiten rund um die Entstehung und die Herkunft der berühmten Musikerfamilie. Die vor Veit ja noch keine war.
Mein niedliches Video über Gräfenroda. Mit Musik und gesprochenem Text. An einer ganz anderen Position auf dieser Seite, als es bei der Präsentation der anderen rund 20 Bachorte und Bachstädte – von 33 – auf meinen Seiten ist. Warum? Damit Sie dieses Video nicht übersehen. Nämlich dann, wenn ich für Sie viel zu tief – und mit viel zu viel Text – in die Genealogie der sehr frühen Bache „eintauche“.
Für ganz bestimmt nur eine Handvoll Bach-Interessierte, die sich ja über Bachs Musik hinaus nicht nur für dessen Leben, sondern dann auch noch für seine Familie interessieren müssen, habe ich - auch hier - ein Kapitel zur Bach-Family verfasst. Eine „Handvoll Interessierte“? Yup, denn vergleichsweise wirklich wenige Menschen wollen mehr über die Bach-Musikerfamilie wissen ... sie besuchen dazu Wechmar. Für die Epoche davor aber interessiert sich schließlich kaum mehr ein Individuum. Lesen Sie gerne deshalb unter der nächsten Anzeige dazu detaillierter.
Halt, halt. Es ist oben kein authentisches Aquarell. Es ist ein kleines Werk, das erst im 21. Jahrhundert entstand. Es zeigt Hans-Veit Bach und seinen Freund Obentrot auf dem Weg nach Böhmen. Zuvor hatte der Pfarrer in der damals sogar noch kleineren Gemeinde Gräfenroda den sogenannten „Reise-Segen“ erteilt. © Peter Bach jr.
Gräfenroda ist für viele Bach-Wissenschaftler und Bach-Forscher so etwas wie ein "rotes Tuch“. Das führt zu Kuriositäten. Einige Bach-Fans sind davon überzeugt, dass dort nicht alles begann. Mit den Bachs. Andere sind der Meinung, dass vielleicht von Gräfenroda kommend, erst viel später aus der Familie Bach eben diese Musikerfamilie Bach wurde. Und: Praktisch alle Bach-Biografen, bis auf einen, lassen wiederum Hans sowie Hans-Veit und Veit 1 plus Veit 2 sogar ganz weg. Und Manchem in der jüngeren Vergangenheit wäre es wohl am liebsten gewesen, Gräfenroda hätte es auf der Landkarte nie gegeben.
Ganz, ganz unglaublich wenige Menschen auf dem Planeten allerdings kennen heute die Wahrheit. Und wie das so ist mit der Historie rund um den berühmten Thomaskantor: Da wird gefunden. Und dann geht es wieder verloren. Später wird es wiedergefunden. Und geht wieder verloren. Aber schließlich ... gibt es ja genau deshalb inzwischen Bach über Bach. Da ... geht es, dank „Digitaler Langzeitarchivierung“ mit einladendem und sympathischen Zugang, nie mehr wieder verloren.
Bei mir und auf dieser Seite kann man heute gerne nachlesen, welche Rolle Gräfenroda in der sehr frühen Bach-Genealogie spielt. Dazu auch, ob Veit aus Ungern kam oder stammte – auf keinen Fall aus Ungarn – oder aus Böhmen, aus Ungernland oder aus Ungerndorf.
Dazu: ob ein Bach von dort „nur“ herzog. Oder ob er nach dort früher auch „wegzog“. Eines steht fest. Und zwar urkundlich. Es gibt da eine Zeit „vor Wechmar“. Also aus unserer Perspektive heute betrachtet. Da war die Familie Bach noch keine Musikerfamilie. Aber es gab sie natürlich schon. Nun, genau genommen ... ist das ja logisch. Irgendwo musste es sie ja schließlich gegeben haben: die Bache, wie sie damals hießen. Inzwischen hat man es herausgefunden. Nachgewiesen. Dokumentiert. In den1950ern. Es ist Fakt. Genealogie schlägt Biografie. Dokumente schlagen Argumente. Und ... ich habe sie dann schließlich entdeckt: die tatsächliche Herkunft der Bache. Aus Ungern. Zusammen mit Michael Lehner. Das alles ... klingt sehr streitsüchtig.
Übernachten in Gräfenroda
Die Schokoladenansicht der „Villa Heimlicher Grund“. Ein herzlicher Dank geht an © Fotograf Thomas Müller, der das Foto oben machte und es mich veröffentlichen ließ.
Wenn Sie in Gräfenroda übernachten möchten und damit Gräfenroda zu einem Ausgangspunkt für Ihre Erkundung des „Landes der Bache“ machen wollen, dann empfehle ich Ihnen ein richtig cooles Ziel. Passend zu einer spannenden Vergangenheit.
Doch zunächst: Warum empfehle ich eine Unterkunft?
Und es ergab sich – wie pathetisch – zu der Zeit, als ich Gräfenroda hier final als Bachort vorstellen wollte. Ein weiteres vorvorletztes kleines Video war fast fertig. Und eben diese „Gräfenroda-Seite“ auch, auf der Sie gerade lesen. Zu den Worten im Video „… man kann gut übernachten“ fand ich dieses Kleinod „Villa Heimlicher Grund“ im Internet ... als Bild zum Text. Ich fragte die Besitzer um Erlaubnis, Bilder und Webseiten-Screenshots für mein Video verwenden zu dürfen. So ergab sich eine besonders herzliche Korrespondenz. Mit so vielen lieben Komplimenten, dass es einfach dieser Ausnahme bedurfte, hier für so ein schönes Angebot Werbung zu machen. Am Rande: Wir übernachten dort nicht günstiger, weil wir dieses Angebot empfehlen. Und wir haben auch sonst keinen Vorteil. Also ... ist es meine redaktionelle Empfehlung. Und keine Werbung.
Eine Homepage-Seite zur „Villa Heimlicher Grund“. Hier kommen Sie nochmals dorthin. © Unser Dank, zwei weitere Fotos auf dieser Seite publizieren zu dürfen, geht an Thüringen.info, an Herrn Henry Czauderna.
Diese denkmalgeschützte „Villa Heimlicher Grund“ ist tatsächlich ein Geheimtipp. Sie steht auf einem parkähnlichen Grundstück. Das Gelände grenzt direkt an die „Wilde Gera“. Dort bietet Familie Stark eine herrliche Ferienwohnung an: 140 Quadratmeter, Wohnzimmer und Esszimmer mit antiken Möbeln, eine gut ausgestattete Küche, drei Schlafzimmer und zwei Bäder ... sind nur einige der Annehmlichkeiten. Auf der Homepage „www.villa-heimlicher-grund.de“ ist alles ausführlicher beschrieben. Und es gibt dort Bilder, die Sie mit einem Klick hier auch direkt und jetzt gleich einmal erkunden können. Dort auf der Seite ... dann ganz unten.
Übernachten mit Stil und das zu einem sehr fairen Preis: Das geht in der „Villa Heimlicher Grund“ bei Familie Stark in Gräfenroda. © siehe oben.
Erbaut wurde die Villa 1886/87 und gekauft hat sie das Ehepaar Stark 2020. Doch vor einem Angebot als edle Ferienwohnung lag viel, viel Arbeit. Gefördert wurde das Projekt von der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“. Ganze fünf Restauratorinnen und mehrere Jahre Arbeit waren nötig, um prachtvollen Malereien unter hässlicher Tapezierung wieder ans Tageslicht zu verhelfen. Dafür bekamen dann alle Beteiligten den Denkmalpreis des Ilm-Kreises. Fünf Jahre dauerte das Abenteuer, immer begleitet von den Experten des Denkmalamtes. Heute ist die gesamte Villa, innen, wie außen, mitsamt dem Park um sie herum ein Schmuck-Ensemble: in dem man eine traumhafte Wohnung mieten kann. Wie wär‘s anlässlich eines ersten oder nächsten Bach-Abenteuers? Und der Name der Villa, nämlich „Heimlicher Grund“? Lesen Sie darüber auch auf der Homepage der Familie Stark.
Anzeige
60 Musik-Kalender, Komponisten-Kalender, Bach-Kalender und Orgel-Kalender
Musik-Kalender, Komponisten-Kalender, Orgel-Kalender, Bach-Kalender. Drei Größen. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Zwei Kalender-Stile. Zu den Verlagsshops.
Bitte unterstützen Sie auch unsere Klassische-Musik-Mission
Hier gibt es unendlich viel zu entdecken: Bach-Geschenkideen und Musik-Geschenkideen. Gerne jetzt?
Nirgendwo sonst finden Sie so viele unterschiedliche Bach-T-Shirts und Bach-Siegel-T-Shirts in einem Verlag. Hier kommen Sie direkt zur Auswahl.
Ende der Anzeige
Interessiert es denn wirklich nur runde vier Menschen auf unserem Planeten?
Gräfenroda ist in der Bach-Literatur praktisch nicht erwähnt. Wenn man es denn an der Gesamtzahl der Bach-Publikationen misst. Ein einziger Bach-Biograf, wenn auch einer der fünf berühmtesten von rund 700, nämlich Philipp Spitta, hat Gräfenroda nur eine halbe Zeile gewidmet. Wenn er auch einräumt, dass die Verbindung zur Musikerfamilie nicht klar ist. Selbst spannende, passende Berichte in der örtlichen Tageszeitung in Thüringen zwischen 1950 und 2000 fanden natürlich – nachhaltig – zu keinerlei Umschreibung der frühen Bach-Familiengeschichte.
Das kann kein Schwein lesen
In Gräfenroda gibt es die Johann-Peter-Kellner-Gesellschaft. Johann Peter Kellner war die herausragende Persönlichkeit in Gräfenroda. Er war Musiker, Organist und Komponist. Zudem war er Lehrer. Weit über Gräfenroda hinaus bekannt war Kellner auch als Orgelvirtuose und als Orgelexperte.
Die Johann-Peter-Kellner-Gesellschaft gibt es seit September 2010. Peter Harder ist Vorsitzender dieser Gesellschaft. Er hat mir in liebenswürdiger Form zu einem Extrakt an Information verholfen. Der machte es mir möglich, nicht in meiner eigenen Homepage suchen zu müssen, um eine der letzten Seiten meiner Bach-Städte- und Bachorte-Präsentation, nämlich über Gräfenroda, abschließen zu können. Dankeschön nochmals auch hier. Übrigens und am Rande: Zu Kellners Wirken wurde sogar eine Doktorarbeit geschrieben.
Die für Ihre anschließende Lektüre spannende Einleitung im Beitrag Peter Harders im Kellner-Kurier der Kellner-Gesellschaft, Ausgabe 9 von 2015, zitiere ich vorab im Wortlaut: „Anhand der zahlreichen Bach-Abschriften ist Kellners Bemerkung glaubwürdig: „Mich verlangte nach der Bekanntschaft dieses vortrefflichen Mannes und wurde auch so glücklich, dieselbe zu genießen.““ (Zitat Ende). Wie verhält sich diese Einleitung mit dem Vorwurf der folgenden Fälschung eines bedeutenden Schriftstückes?
Wir bemühen KI
Der Artikel im Kellner-Kurier bezieht klar Stellung. Peter Harder unterstellt eine liebenswürdige, aber eben doch, eine Fälschung. Er nennt als ganz wesentliches, wichtigstes Kriterium, dass Kellner im weiter unten besprochenen Schriftstück, damals als „Kantor“ bezeichnet ist. Zu einer Zeit, als Kellner noch gar kein Kantor gewesen sein konnte. Sondern Organist war. Gibt es um das Jahr 1700 noch andere Begriffe für einen Organisten? KI antwortet: In ländlichen Gebieten waren Organist und Kantor oft dieselbe Person ... dort wurde meist nur ein Titel verwendet (... z. B. „Schulmeister“ oder „Kantor“).
Ich formuliere eine zweite Frage an „meine“ KI: Gibt es im Jahre 1700 noch einen anderen Begriff für Kantor (... hier jetzt also der Gegencheck ... sozusagen ... jetzt frage ich zum Begriff „Kantor“)? Die KI meint: Ja, es gibt mehrere Begriffe, die um 1700 als Synonyme oder verwandte Bezeichnungen für einen Kantor verwendet wurden. Abhängig vom regionalen, konfessionellen oder institutionellen Kontext. In vielen kleineren Gemeinden war der Kantor gleichzeitig der Lehrer an der Dorfschule. Daher wurde er oft „Schulmeister“ genannt. In vielen Fällen war der Kantor auch Organist, sodass beide Rollen zusammenfielen.
Ich neige jetzt dazu, mit KI weiterzuforschen. Meine dritte Frage: Kann es sein, dass um das Jahr 1700 in einem kleinen Ort der Lehrer und Organist auch als Kantor bezeichnet wurde? Die Antwort: Ja, absolut ... das war sogar die Regel in vielen kleinen Orten um das Jahr 1700. In kleinen Orten war der Kantor meist in Personalunion: Lehrer, Organist, Kirchensänger und oft auch Chorleiter ... alles in einer Person. Der Begriff „Kantor“ wurde häufig als Oberbegriff verwendet ... selbst wenn die Orgelspiel-Tätigkeit dominierte. In kleinen Orten war die Trennung der Ämter (... wie in Städten) kaum möglich oder finanziell machbar. In Quellen kann dieselbe Person zum Beispiel genannt werden als: Kantor und Schulmeister, Organist und „Lehrer Cantor loci“. Oder schlicht nur: Kantor, wobei alle Funktionen damit gemeint waren.
Bin ich „KI-vernarrt“? Um Himmels willen nein ... ich kann mit ihr umgehen. Obwohl ... KI liefert immer einen spannenden Beitrag zu praktisch allen Themen. Die müssen dann aber selbstverständlich sorgfältigst verifiziert werden. Das allerdings „schenke ich mir hier“, weil es mir ausreicht, die Problematik mit der Bezeichnung „Kantor“ im Kellner-Kurier nur zu beleuchten.
Zurück zum Kellner-Kurier
Mit meiner Lektüre des Artikels stellte ich fest, dass im Kellner-Kurier, und zwar in der Ausgabe 9 vom September 2015, noch bis dahin unbekannte Hinweise aufgeführt sind. Sie deuten an, dass Bach wohl nicht nur einmal, sondern mehrmals in Gräfenroda gewesen war (... Sie lasen es als Einleitung weiter oben). Peter Harder schrieb seine eigene Publikation im erwähnten Kellner-Kurier etwa zur selben Zeit, als ich auf ganz anderem Wege nach Gräfenroda „fahndete“. Und dabei die Zusammenhänge „der Vergangenheit entriss“.
Das Verhältnis Kellners zu Bach, musikalisch und persönlich, ist uns seit den Jahren 1728 und 1729 bekannt. Kellner und seine Schüler schienen alles an Bach-Kompositionen zusammengetragen zu haben, „was ihnen in die Hände fiel“. Kellner meinte ja: „Mich verlangte nach der Bekanntschaft dieses vortrefflichen Mannes und wurde auch so glücklich, dieselbe zu genießen“ (Zitat). Es ist der entscheidende Hinweis, dass Bach tatsächlich in Gräfenroda war. Bleibt also nur, dass Bach zwar dort war, aber nicht genau getan hatte, was niedergeschrieben war?
Kellner wurde zudem bei Bernhard Bach in den „Bach-Freundeskreis“ aufgenommen. Das beweisen Korrespondenzen unter Bach-Schülern.
Im Heute fanden nun die Recherchen von Peter Harder und meine eigenen zusammen. Der Kellner-Kurier mit dem Beitrag von Peter Harder lässt nicht offen, ob es sich bei einem
Dokument aus dem Jahr 1728 um eine Fälschung oder um eine glaubwürdige Überlieferung handelt. Ich habe meine Erkenntnisse aber direkt aus den Ergebnissen der damaligen kleinen
Expertengruppe um Professor Kraft, einer Frau Dr. Niemeyer und auch durch den lokal sehr bekannten Arnstädter Helmuth Karl Abendroth extrahiert.
Dabei ist spannend, dass ich mich gar nicht so sehr für Gräfenroda als Bachort, sondern mehr zur Herkunft der Bache aus Ungern interessierte. Auch, ob Johann Sebastian Bach tatsächlich in Gräfenroda war, war zu diesem Zeitpunkt für mich noch uninteressant. Für mein Ziel nämlich, ob es diese Bachs waren, die auswanderten, habe ich runde 600 von 800 Seiten der Habilitation von Prof Kraft, die mir die Uni Halle zur Verfügung stellte, und die Krafts Schwiegersohn, Professor Wahl, mir erlaubte, auszuwerten, bis heute transkribiert. Das heißt, dass meine Publikation wesentlich aus der Korrespondenz der Forschergruppe untereinander und mit denen entspringt, die damals für einen Betrug „anzuklagen“ gewesen werden müssten. Meine Forschung galt also mehr der Bewertung der Glaubwürdigkeit, als ich mit der Kenntnis vieler Aspekte schließlich auch an dem „Kann-kein-Schwein-lesen-Dokument“ vorbeikam.
Es geht also jetzt um ein Schriftstück, dass es heute nicht mehr gibt. Und meine persönliche Ansicht ist es, dass es vom damaligen Kultusministerium der DDR in Ost-Berlin unterschlagen, wenn nicht sogar vernichtet wurde. So, wie ebenfalls ein Kirchenbuch, das nie mehr „auftauchte“. Mehr dazu kann man in meiner Bach-Genealogie 2012 / 2015 / 2021 lesen. Ein Pfarrer Schneider hat 1728 eine Art Protokoll in „ein Heft niedergeschrieben“, das über den Ortspfarrer in den 1950er-Jahren an Frau Dr. Niemeyer zu Professor Günther Kraft gelangt war. Der Ortspfarrer in Gräfenroda hatte dieses Dokument an Frau Dr. Niemeyer verschenkt. Das mit den Worten: „Das Geschriebene kann ja sowieso kein Schwein lesen“. Professor Kraft aber konnte es.
Es ist das Protokoll des Gräfenrodaer Pfarrers Jeremias Schneider, der den Besuch von Johann Sebastian Bach in Gräfenroda am 28. September 1728 festhielt. Die komplette Beschreibung des Besuchs
von Johann Sebastian Bach, das gemeinsame Musizieren und Themen zu Ahnen und Herkunft können Sie auf meinen Genealogie-Seiten nachlesen. Explizit ist spannend, dass auch in diesem
Schriftstück – wie auch in der Kirchenbuße – das Jahr 1504 erwähnt ist. Am Rande: Bach schrieb seine Addition der 50 Mitglieder in seiner Family erst sieben Jahre später nieder. Vile der dort
aufgeführten Herren machten übrigens gar keine Musik.
Damit ergeben sich im Artikel im Kellner-Kurier ... Zitat ... folgende Überlegungen und zahlreiche Ungereimtheiten. Zitat Ende. Explizit führt Peter Harder sinngemäß zwei Diskrepanzen an. Zum Beispiel, dass Kellner zweimal als Kantor bezeichnet wurde, der das aber noch nicht zum damaligen Zeitpunkt gewesen sein konnte. Und klar auch, sind es Widersprüche, wenn sich einer der Beteiligten an, wegen des Orgelsounds, schwingende Leuchter in der Kirche erinnerte, es aber nur eine kleine romanische Kirche in Gräfenroda damals war. Meine Meinung? Auch in gewaltig großen Kirchen schwingen keine Leuchter, weil die Toccata so mächtig klingt. Das waren wohl eher „gefühlte, imaginäre Schwingungen“.
Nun bleibt es offen?
Die Argumente im Kellner-Kurier geben zu denken. Allerdings reicht es natürlich nicht, dass es „eine große Verlockung für die Gräfenrodaer“ war, sich mit dem Besuch Bachs unredlich zu schmücken.
Dazu wird vermutet, dass Schneider sicher nicht alle Verwandten Bachs, die er aufzählte, aus dem „FF kennen konnte“. Wäre beides berechtigt, dann wäre die ganze Geschichte ja sogar eine
Verschwörung.
Ich interessiere mich, etwa seitdem ich mit meinem Bach-Portal begann, auch ganz allgemein für Geschichte und weltweite archäologische Entdeckungen. Und ich war und bin erstaunt, zum Teil
entsetzt, wie sehr Geschichte, Funde und Erkenntnisse in vielen Disziplinen gebeugt wurden und werden. Trotzdem und in diesem Fall: Mir liegt Originalkorrespondenz vor, die ganz klar
aufzeigt, dass aktiv ( ! ) manipuliert wurde. Das, um historische Entdeckungen in Sachen „Gräfenroda und Bach“ zu verschleiern: und sie in den Mühlen der Zeit zu „versenken“. Ein
Satzfragment in dieser Originalkorrespondenz lautet sinngemäß: „Gräfenroda der Ursprung der Bachs? Die Musikerfamilie waren also Bergleute? Da erscheint uns doch Dr. Schweitzers „Bachbild“ richtiger.
Wir haben hier in der DDR eine stabile Bach-Historie und wer bin ich, dass ich das in Frage stelle“ (… sinngemäße Wiedergabe einer mir bekannten Persönlichkeit im damaligen Ost-Berlin in der
DDR).
Dazu: Ich habe mich wochenlang, besser monatelang, mit dem Thema „Die Bachs aus / in Gräfenroda“ auseinandergesetzt. Ich bin dazu auch tief in die Arbeit von Abendroth / Dr. Niemeyer / Professor Kraft „eingedrungen“. So habe ich bis heute - wie bereits erwähnt - 600 von 800 Seiten der Habilitation von Professor Kraft, die nie veröffentlicht wurde, transkribiert. Zum Teil waren ganze Seiten kaum mehr lesbar. Für mich ist die Existenz dieses oben erwähnten Schriftstückes, das zunächst „kein Schwein“ lesen konnte, damit schlüssig.
Es geht natürlich auch ganz ohne KI
Alternativ: Lassen Sie uns auf KI verzichten. Damit ergeben sich weitere Ansätze, die für die Echtheit des gefundenen Dokuments sprechen. Zunächst ist da eine schlichte Verwechslung denkbar. Der Autor des Schriftstücks, „das kein Schwein lesen konnte“ hat einfach in seiner Begeisterung die Worte „Kantor“ und „Organist“ verwechselt. Unglaubhaft? Carl Philipp Emanuel Bach hat sogar Ungern mit Ungarn verwechselt. Oder er hat es absichtlich verändert. Außerdem könnte es sich auch um eine Form der Einschmeichelei oder des Anbiederns gehandelt haben, die der damalige Autor dem Organisten Kellner so zukommen ließ. Natürlich nichtsahnend, was er damit anrichtete.
Nächste Überlegung: Welche Gründe könnten den Autoren des Schriftstückes (… oder die Autorin, das muss man der Gleichberechtigung wegen hier schon auch anmerken) dazu veranlasst haben, einen solchen Betrug zu initiieren? Jetzt muss man davon ausgehen, dass es nicht die Forscher in den 1950ern waren, die diese Fälschung anstellt haben könnten. Und auch: Welche besonderen Kenntnisse musste der Schreiber da gehabt haben?! Außerdem stellt sich die Frage nach dem „Warum“. Wollte der „Chronist“ etwa schon 1728 vorbereiten, was passiert, wenn man 250 Jahre später dieses Dokument entdeckt und Gräfenroda dann zum „Bach-Pilgerziel“ wird?! Wobei man in Betracht ziehen muss, dass das Dokument zum Zeitpunkt seiner Datierung gefälscht worden sein muss. Und alternativ zum Zeitpunkt des Verschenkens an Frau Dr. Niemeyer? Eine Fälschung um 1950 anzufertigen und sie dann nicht zu nutzen, scheint recht unsinnig.
Schließlich meine Antithese: Wir können die beiden Wissenschaftler, Niemeyer und Kraft, im „Team 1950“ als äußerst seriös betrachten. Man forscht nicht für ein 800-Seiten-Buch und fälscht dann nebenbei ein historisches Schriftstück. Beziehungsweise gestaltet eines. Dann waren auch mehrere Kenner der Materie an der Bewertung beteiligt. Allerdings ist keinem dieser Gruppe vor 70 Jahren aufgefallen, dass Kellner kein Kantor, sondern Organist gewesen sein musste. Zudem „kontrollierte“ sich dieser Kreis defacto selbst. Professor Günther Kraft beschäftigte sich mit der Deutschen Musik über die Jahrhunderte. Penibel. Ich kenne, als einer von wenigen Menschen, das fertige Manuskript. Er war der anerkannte Spezialist in seiner Disziplin. Und der kann dann einen Organisten nicht von einem Kantor unterscheiden? Einem der fünf in dieser Gruppe (… ich führte nur drei namentlich auf, es waren aber wenige mehr) müsste doch aufgefallen sein, dass Kellner noch nicht Kantor gewesen sein konnte. Und dass dieser Terminus ja von außerordentlicher Bedeutung gewesen war, wenn er denn einen Betrug entlarvt hätte.
Qui bono? Besser … Cui profuisset?
Wem hätte es genutzt? Den Gräfenrodaern, denen Harder es, aber nur ganz vorsichtig, unterstellt? Kaum. Genutzt hätte es nicht zur Zeit der Entstehung des Dokuments. Da hat sich schon im Nachbarort keiner mehr dafür interessiert. Dann in den 1950ern? Aber warum sollten Wissenschaftler, die nicht Gräfenrodaer sind, Gräfenroda so sehr ins Scheinwerferlicht der Bach-Geschichte stellen wollen? Gut … es untermauert natürlich, im Falle der Echtheit von Professor Krafts Erkenntnis, dass es diese Bachs waren, die einst von Gräfenroda nach Böhmen wanderten. Und dann wieder zurückkamen.
Allerdings: Es wäre ein wenig auch der „Speck ufd Würscht“, wie man bei uns im Schwäbischen sagt. Nämlich, dass der Bach-Besuch in der geschilderten Weise etwas mit der 200 Jahre früheren Auswanderung der Bache zu tun gehabt haben könnte. Dazu kommt auch, dass keiner der „1950er-Forscher“ Gräfenrodaer war. Und also nicht aus touristischer Erwägung betrogen haben könnte. Ganz abgesehen davon, dass vor dem Mauerfall sich wohl – im Falle der „Adelung“ von Gräfenroda – kein einziger zusätzlicher Tourist nach Gräfenroda verirrt gehabt hätte.
Was meinte man in Berlin? Auch die Analyse der Echtheit des Schriftstückes durch hochqualifizierte Musikwissenschaftler im Ost-Berlin der DDR, denen man das Dokument zur Prüfung zusandte, führte nicht zu der Erkenntnis, die heute im Fokus steht. Nämlich die Entdeckung, dass Kellner zur Besuchszeit von Bach kein Kantor gewesen war. Diesen "Herren" in Berlin aber wäre es „ein inneres Missionsfest“ gewesen, wenn sie diesen Betrug schon vor 70 hätten aufdecken können. Aus der mir vorliegenden Korrespondenz geht das aber nicht hervor. Mit einer solchen Entdeckung hätte man diese Zeilen nämlich retournieren können (… was man ja nicht getan hatte). Damit hätte man die Herkunft der Bache aus Gräfenroda nachdrücklicher anzweifeln können … und das sogar qualifiziert. Und nicht mit dem oben aufgeführten „Quark vom stabilen Bachbild des Dr. Schweitzers in der DDR“.
Es ist auch schlüssig, dass eben kein Betrug stattfand, weil für das Gegenteil ebenso wenig Originaldokumente vorliegen. Nach meiner von allen Seiten anerkannten Korrespondenz
müsste man demnach davon ausgehen, dass mindestens die vier Beteiligten, der damalige Ortspfarrer in Gräfenroda, Lokalhistoriker Abendroth, Dr. Niemeyer und auch Professor Kraft – gemeinsam und
wissentlich – betrogen haben. Das erscheint mir einfach so sehr unwahrscheinlicher als das Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass so viele Komponenten stimmig sind. Ich bin
der Meinung, Johann Sebastian Bach war tatsächlich in Gräfenroda. Und unabhängig davon ( ! ) hat das nichts damit zu tun, dass Gräfenroda ein Bachort ist.
Wie man es auch „dreht und wendet“ … die Einwände gegen die Echtheit des in den 1950er-Jahren verschenkten Berichts sind nicht nachhaltig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das alles „seine Ordnung“ hat, scheint mir um ein Vielfaches höher als die Verschwörungstheorie der „konspirativen Täuschung“. Aber … das ist ja nur meine eigene Meinung. Und die meiner Frau.
Nun also „adle“ ich in meiner Funktion als einer der Familiensprecher der Bache, Gräfenroda zu einem „richtigen“ Bachort. Und ich nutze gleichzeitig die Möglichkeit, durch mein Bach-Portal, diese Erkenntnis weit, weit in die Zukunft zu transportieren. Für jeden den es interessiert. Vielleicht nach einem ersten „lokalen Aha“ jedes Jahr vier weitere Menschen?!
2 Musik von Bach und Bilder von Gräfenroda
Das Video ganz ohne „störenden Text“. Gräfenroda in Bildern. Dazu ein Musikwerk von Bach.
3 Der Bachort Gräfenroda in ein paar Bildern
Dieses Foto kann man nur aufnehmen, wenn man keine Angst vor herannahenden Zügen hat. Gräfenroder ... oder sind es Gräfenrodaer? ... wissen, was ich meine. Und ich weiß: Das ist ... nicht nur eigentlich ... nicht akzeptabel. Ein paar wenige hübsche Fotos mehr gibt es
4 Information über den Bachort Gräfenroda
Gräfenroda ist ein kleiner Ort, aber mit immerhin 3.200 Einwohnern. Es gibt eine Gartenzwergfabrik in der Ortsmitte. So ein Zwerg zierte sogar einst die offizielle Homepage der Gemeinde. Dort hatte er auch seine Daseinsberechtigung. Überhaupt erfährt man, dass das ganze Gartenzwerg-Handwerk, also sozusagen die „Gartenzwerg-Industrie“, ihre Wiege in Gräfenroda hatte. Erstmals erwähnt ist Gräfenroda im Jahr 1290. Fast selbstverständlich ist es, dass es in Gräfenroda auch ein Zwergen-Museum gibt, nämlich das Zwergen-Museum Griebel. In Gräfenroda findet dort auch ein Glas-Studio, natürlich mit Homepage.
Wenn Sie jemals gefragt würden, was Bach und Gartenzwerge gemeinsam haben, dann ist es vielleicht dieser kleine, freundliche Ort an der „Wilden Gera“, wo alles begann. Mit der Bachfamilie und den sieben Zwergen. Nein, nicht sieben ... das ... war nun wieder eine ganz andere Geschichte.
5 Ein kurzes Video über Gräfenroda ... hier gerne nochmals ... falls Sie ...
... die Einladung ganz weit oben übersehen oder übersprungen haben. Das gleiche Video über Gräfenroda nochmals? Ja und Nein, es ist ein anderes Filmchen als das ganz in der Nähe weiter oben. Aber es ist schon dasselbe Video, wie ganz zu Beginn der Seite. Während das kleine Werk in der Nähe nur aus Bildern und Musik besteht, können Sie sich mit dem Clip hier auch informieren.
6 Wo genau liegt denn dieser Bachort?
Auf der Karte oben sieht man deutlich, wie nahe der Bachort Gräfenroda an den Ortschaften Arnstadt und Ohrdruf ... wenn man etwas scrollt ... und auch an dem Bachstammort, nämlich Wechmar, liegt. Schon Philipp Spitta erwähnte den Ort Gräfenrode in seiner Biografie. Vor langer, langer Zeit. Wie richtig er mit seinem Hinweis und dem zugehörigen „Hans“ einst lag, wurde aber erst viele, viele Jahrzehnte später erkannt. © Google Maps.
Anzeige
Bach-Kalender über Bach-Kalender: insgesamt 20 coole Werke
Links ist es das Bach-Drehkastl aus dem Erzgebirge. Und rechts? Bach-Kalender sind tolle Geschenke für Musiker. Drei Größen. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Zum Shop.
Bach-T-Shirts, Mozart-T-Shirts, Beethoven-T-Shirts ... und Musik-T-Shirts ... und ... 20 Bach-Kalender gibt es auch
Unzählbar viele Bach-Geschenkideen? Wahrscheinlich schon. Jetzt vielleicht zu einem der fünf Bach-Onlineshops? Mit einem Klick hier.
Es gibt hippe und coole Bach-Kalender. Aber es gibt auch sehr konservative Bach-Kalender. Eben für jeden Bach-Fan den richtigen.
Ende der Anzeige