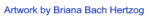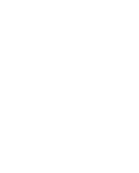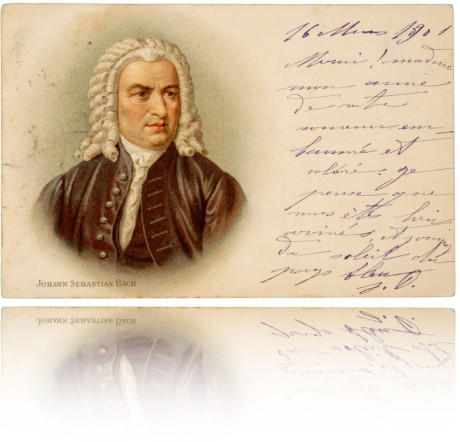Biografie? Kurzbiografie? Johann Sebastian Bach ... das Leben des Meisters in 60 Minuten..
Johann Sebastian Bach - Text zum Lesen, Bilder zum Ansehen, Videos zum Erleben - das finden Sie auf diesen unterschiedlich langen Biografie-Seiten meiner Johann-Sebastian-Bach-Homepage. Genießen Sie den Lesespaß in vielen Varianten: mit Bach-Videos, durch die Sie die Bachstädte und Bachorte kennenlernen können. Oder mit vielen Videos ohne gesprochenen Text: dafür jeweils mit einem von Bachs bekanntesten Werken ... und dazu Bilder der Bachstädte und Bachorte. Oder Sie lesen die Kurzbiografie in 25 Minuten und schalten sich einfach die Musik von Bach auf der passenden Seite „dazu ein“..
Anzeige
800 Bach-Bücher und 60 Musik-Kalender, Komponisten-Kalender und Bach-Kalender..
800 Bach-Bücher? Tatsächlich! Mit unserem Partner jpc. Er ist Musikalien-Marktführer in Europa und bietet Bach-Biografien, Bücher zu Bachs Musik sowie zu seiner Familie an. Und alle diese Publikationen sind durchlaufend aufgeführt und nicht von Werbung, Bachblüten-Publikationen oder Büchern von Autoren mit dem Namen Bach unterbrochen. Zum Shop..
Von 60 Musik-Kalendern sind es alleine zehn Orgel-Kalender. Und dazu gibt es die meisten auch als Broschüren-Kalender. Dieses Jahr und nächstes Jahr. Hier kommen Sie direkt zur Kalender-Übersicht..
Bettwäsche, Bettbezüge, Küchenschürzen, T-Shirts, USB-Sticks, Schlüsselanhänger ... und so viel mehr: Das gibt es alles mit Designs des „Bach 4 You“-Verlags. Ein Klick ... und Sie haben tatsächlich die Qual der Wahl..
Ende der Anzeige
Jetzt ... wird die Bach-Biografie multimedial
Meine mit 60 Minuten Lesespaß längste der acht Kurzbiografien über Johann Sebastian Bach bietet Ihnen etwas ganz Besonderes. Sie können sich nämlich Abschnitt für Abschnitt verschiedene kleine Video-Stadt- und Ortsporträts ansehen und anhören.
Es sind niedliche, superkurze Videos, und zwar über die Wohn- und über die Wirkungsorte des Komponisten. Es gibt außerdem eine kleine Show über Wechmar, eine über Erfurt und eine über Gotha. Dazu eine über Gräfenroda, über Janegg in Tschechien und eine über Hanfthal und Ungerndorf in Österreich: Manche Städte und Orte sind Bach-Locations, wenn auch keine Locations, in denen Johann Sebastian Bach mehr als einmal oder zweimal oder nur ultrakurz wirkte. Wechmar als Bach-Ort ist deshalb von Bedeutung, weil hier alles rund um die Musikerfamilie begann. Alle diese kleinen Videos sind richtige, aber trotzdem kurze Porträts der Städte und Orte heute. Die Texte sind von Profis gesprochen und sie sind sowohl mit Musik von Bach, als auch mit aktueller Musik vertont.
Es lohnt sich also, die drei längeren Versionen meiner Bach-Kurzbiografien daraufhin zu erkunden, was es an multimedialem Schnickschnack gibt. Dabei sind die Videos über die Bachstädte und die Bachorte kurzweilig, also „auf den Punkt“, gestaltet. Und sie sind zeitgemäß mit sehr kurzen Standzeiten der Fotos und Filmsequenzen ausgestattet. Trotzdem erfahren Sie alles, übersichtlich, über die jeweilige Bachstadt ... oder den jeweilige Bachort.
Zusammengefasst sind das, zum Beispiel, nochmals die drei Varianten:
1. Die Bach-Biografie in 15 Minuten: Sie ist mit historischen Postkarten der Bach-Locations illustriert. Hier kommen Sie hin.
2. Die Bach-Biografie in 25 Minuten: Sie ist mit Videos ohne Information zu den Bach-Orten und Bach-Städten angereichert. Natürlich aber mit Bachs Musik. Ist das die richtige Länge?
3. Die Bach-Biografie in 60 Minuten auf dieser Seite meiner Homepage: Auf ihr gibt es jeweils zwischen drei und fünf Minuten lang gesprochene Information, Bilder, Filmsequenzen und Musik. Lesen Sie bitte einfach weiter.
Johann Sebastian Bach
Das Video Nummer 1 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Wechmar heute aussieht. Wechmar bei Gotha ist keine der Johann-Sebastian-Bach-Städte. Doch hier begann einst die Geschichte der Musikerfamilie Bach. Und Wechmar ist in Sachen Bach mehr als einen Besuch wert.
Das Video Nummer 2 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Gotha heute aussieht. Gotha ist keine der Johann-Sebastian-Bach-Städte, doch hier spielte Bach mindestens einmal und andere Bache musizierten ebenfalls in Gotha ... deshalb ist Gotha eine Bachstadt.
Die Geschichte der berühmtesten Musikerfamilie der Welt begann in einem kleinen Ort in Thüringen: in Wechmar. Wechmar liegt vor den Toren einer traumhaften Stadt, Gotha. Der erste Musiker der Dynastie war Veit Bach. Obwohl die Geschichte der Bache bereits 110 Jahre früher beginnt, liegt über den ersten Musikanten, Veit Bach, der erste Kirchenbucheintrag zur Familie vor. Er datiert 1619.
Johann Sebastian Bach war Lichtgestalt in dieser weit verstreuten Familie an Musikern. Er war begnadet, besonders begünstigt. Seine Zeit begann aber immerhin erst ein dreiviertel Jahrhundert nach 1619. Die Bache waren eine Sippe, die im Herzen Deutschlands – in Thüringen – seit vielen Jahrhunderten beheimatet war. Ein Clan, wie er niemals später noch einmal zu finden war. In dieser Familie der Bache, wie man sie damals nannte, vererbte sich ganz offensichtlich das Talent zum Musizieren durch viele Generationen hindurch. Auch in den verschiedenen Seitenlinien. Alleine der Name Bach erlaubte es dem einen und dem anderen Musiker in manchen Städten Thüringens - mit einem besonderen Anrecht - zu den verschiedensten Anlässen aufzuspielen. Dazu auch, Ämter und Positionen zu bekleiden. Zu Kalenderfesten und Familienfeiern, zu Aufzügen und zu Tänzen spielten sie als Stadtmusikanten und Hofmusiker. Aber auch als Organisten und Kantoren verdienten sie ihr Geld. Besonders den Gottesdienst auf der „Königin der Instrumente“, der Orgel, zu begleiten, war mit dem Namen Bach ein bisschen einfacher zu erreichen, als mit jedem anderen Namen.
Ein regelrechtes Handwerk war „Musik machen“ damals. Ein Gewerbe: Lehrlinge gab es und auch Gesellen. Vom ernsten Gottesdienst bis hin zu heiteren Anlässen begleiteten Bache mit ihrer Musik über die Jahrhunderte. Ein frühes Flugblatt aus dem Jahr 1600 weist darauf hin: „Hier siehst du geigen Hansen Bachen - wenn du es hörst, so mußt du lachen“. Vor Johann Sebastian Bach schon lebten und verdienten Bache ihren Lebensunterhalt mit Musik: Aber alleine während seines Lebens gab es 44 Musikanten in Thüringen und in Sachsen mit diesem Namen, die dies ebenfalls taten. Davon waren viele professionelle Musiker mit dem Namen Bach ... und das aus einer Familie!
2
Erfurt und Eisenach
Das Video Nummer 3 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Erfurt heute aussieht. Erfurt ist die Bachstadt überhaupt. Mit mehr als 60 Eintragungen zu Familienmitgliedern in den Kirchenbüchern zu dieser Musikerfamilie. Aber ... Erfurt ist eigentlich keine „Johann-Sebastian-Bach-Stadt“.
Das Video Nummer 4 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Es ist die „Bachstadt aller Bachstädte“: Eisenach. Sehen Sie sich an, wie die Stadt unterhalb der weltberühmten Wartburg heute aussieht. In Eisenach ist Johann Sebastian Bach geboren und hier lebte er die ersten zehn Jahre. © Info.
Natürlich war der Vater von Johann Sebastian Bach, Johann Ambrosius Bach, Musikant. Und dessen Vater war ebenfalls Musiker. Nämlich Kunstpfeiffer. Erfurt war zunächst die Heimat von Johann Ambrosius. In der städtischen Musikkompanie war er angestellt. Ambrosius heiratete Elisabeth Lämmerhirt, die Tochter eines angesehenen Erfurter Bürgers. Nach seiner Heirat wurde er nach Eisenach berufen. Als Stadt- und Hofmusiker. Am 21. März 1685 begann hier, nicht weit vom Bachhaus entfernt, das Leben eines der größten Musiker aller Zeiten: das Leben von Johann Sebastian Bach. Eine liebenswürdige Legende berichtete eine lange Zeit davon, er sei in einer Nische der Georgenkirche während des Orgelspiels zur Welt gekommen. Gemessen daran, dass die Geburt inzwischen vor weit über 300 Jahren stattfand, ist die heutige wissenschaftliche Erkenntnis, dass das Bachhaus doch nicht das Geburtshaus ist, relativ jung.
Aus der Kindheit von Johann Sebastian Bach ist praktisch nichts bekannt. Man darf annehmen, dass sie nicht ganz einfach war. Denn es wird vermutet, dass er - auch in seiner Freizeit - zusammen mit dem Vater am Broterwerb für die Familie beteiligt gewesen war. Er sang und spielte wahrscheinlich schon Geige sowie Bratsche. Und das bei Hochzeitsfeiern. Und auch bei Begräbnissen. Für die Bach-Familie war das ein wichtiges Zubrot in dieser Zeit. Auch in Gastwirtschaften spielte Ambrosius mit dem kleinen Johann Sebastian auf. Mit „... lustigen Weisen“, wie es damals hieß, „... um die Jugend zum Tanze zu locken“.
Ehrgeizig war Ambrosius und ließ allen seiner Söhne eine sorgfältige Musikerziehung angedeihen. Neben Johann Sebastian musizierten auch noch vier seiner Brüder. 1694 - Johann Sebastian Bach war gerade einmal neun Jahre alt - verlor er seine Mutter. 1695 dann, also kurz darauf, starb zunächst sein Onkel und dann schließlich auch der Vater.
In der Quarta der Stadtschule lernte der kleine Johann Sebastian damals besonders Latein und Religion. Musikunterricht bekam er wahrscheinlich nicht nur vom Vater, sondern auch von seinem Onkel, Johann Christoph Bach. Der war an der Georgenkirche, in Eisenach, Organist. Er war es wohl, der den jungen Johann Sebastian dem Orgelspiel und auch dem Komponieren näherbrachte. In dieser Zeit vermutet man den Beginn der Liebe Johann Sebastians zur Orgel: als er an Sonntagen ganz sicher neben dem Onkel, an dessen Seite, saß und dem majestätischen Klang der Orgel lauschte. Ehrgeizig soll er gewesen sein. Bereits in jungen Jahren.
Anzeige
Unsere „Bach-Mission“ und unsere Mission „Klassik für Kinder“
Mit jedem Kauf in einem der „Bach 4 You“-Shops fördern Sie unsere Bach-Mission und unsere Mission „Klassik für Kinder“. Dankeschön. Hier kommen Sie zu den fünf Shops.
Einer der jüngsten, coolen Bach-Kalender.
Ende der Anzeige
3
Lernen und Leben in Ohrdruf
Das Video Nummer 5 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Ohrdruf heute aussieht. In Ohrdruf lebte und lernte Johann Sebastian Bach drei Jahren lang.
Nachdem Johann Sebastian Bach nun Vollwaise war, verließ er die Einsamkeit des Elternhauses in Eisenach in der damaligen Fleischgasse. Sein Weg führte ihn, zusammen mit seinem älteren Bruder zu seinem ältesten Bruder nach Ohrdruf. Ohrdruf liegt am Nordrand des Thüringer Waldes. In Ohrdruf war Johann Sebastians Bruder Johann Christoph, der nach dessen Onkel benannt war, Organist. Johann Christoph war noch beim berühmten Orgelkomponisten Johann Pachelbel in die Lehre gegangen. Pachelbel hatte eine Zeit lang in Eisenach gewirkt.
Bereits drei Söhne hatte Johann Sebastians ältester Bruder selbst. Zu der Zeit, als das Nesthäkchen der Bachschen Familie mit dem gemeinsamen Bruder aus Eisenach in Ohrdruf ankam. Übrigens wurden aus allen vier Söhnen Johann Christophs tüchtige Musiker. Liebevoll nahm er Johann Sebastian und den zweiten Bruder bei sich auf. In Ohrdruf besuchte Johann Sebastian eine Schule von hervorragendem Ruf. Er lernte dort bis zur Prima. Griechisch, Lateinisch und Deutscher Sprachgebrauch standen auf dem Stundenplan. Mathematik selbstverständlich ebenso.
Auch Johann Christoph erkannte die ungewöhnlichen Begabungen seines Bruders sehr früh. Und er förderte dessen musikalische Begeisterung. Klavier- und Orgelspiel, und die Unterweisung in der Generalbass- und Kompositionslehre gelangen ihm derart, dass Johann Sebastian die Freude auch bei vielem Üben nicht verlor. Johann Sebastian in seinem Eifer, fast Übereifer, ein wenig zu dämpfen, das ist zu Johann Christophs Leistung überliefert.
4
Von Thüringen zu Fuß „ins Ausland“ ... nach Lüneburg
Das Video Nummer 6 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Präsentation mit Information. Sehen Sie sich an, wie Lüneburg heute aussieht. Wo Johann Sebastian Bach zwei Jahre lebte, musizierte und lernte. © Info.
Zum Ende seiner Zeit in Ohrdruf lief auch Bachs Stipendium dort aus. Und sein ältester Bruder brauchte nun auch mehr Platz für seine eigene Familie. So kam es, dass Johann Sebastian Bach und dessen Schulfreund Georg Erdmann einfach ohne feste Zusage nach Lüneburg wanderten. Immerhin war es eine Strecke von runden 350 Kilometern. Beide wurden dort vollkommen problemlos aufgenommen. In Lüneburg steigerte sich die Qualität der Ausbildung und des Unterrichts noch einmal ... und sie wurde auch umfangreicher. Neben freier Unterkunft und freier Kost bekamen die Schüler damals auch einen kleinen Anteil an den eingespielten Geldern, die der Chor von Stiftungen erhielt. Und sie waren zu einem kleinen Teil auch an den Einkünften beteiligt, die sich beim Straßensingen, bei Hochzeiten oder bei ähnlichen Anlässen erwirtschaften ließen.
Schon in der Lüneburger Zeit drängte es Bach zu ersten Kompositionen. Ganz besonders zu Kompositionen für die Orgel. Sie war wahrscheinlich Bachs Lieblingsinstrument. Obwohl er allerdings, ähnlich seinem Vater Ambrosius, auch ein begnadeter Geigenspieler war. Ebenso spielte er die Bratsche. Mit diesem Können wirkte er in Quartetten und in größeren Instrumentenchören mit. In Lüneburg schrieb er auch seine ersten Präludien und Fugen. Und er begann, eine hohe Aufgabe zu sehen „... im Vervollkommnen der Fugenform, die ihm in der streng geordneten Folge voneinander bestätigenden oder widersprechenden Stimmen, in der lebendigen Gliederung von Gleichnis und gewandelter Nachahmung, von Einigung und Trennung, von Gegensatz, Entsprechung, Zwischenspiel und Verdichtung wie ein Sinnbild der Weltenharmonie schienen“. So beschrieb das der Bach-Biograf Felix Adam Kerbel bereits 1896.
Auch Bach kam schließlich an einem Punkt im Leben an, den, zu jeder Zeit, fast alle junge Menschen auch heute noch erleben: nämlich als es galt, sich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung zu entscheiden. Siebzehnjährig stand Johann Sebastian in Lüneburg an einer solchen „Lebens-Kreuzung“. Und so entschied sich Johann Sebastian, die vergleichsweise wenigen Kilometer von Lüneburg nach Hamburg zu wandern, um dort in der Katharinenkirche einen der angesehensten Orgelspieler anzuhören. Der war ein Meister seines Genres: Es war der bereits 81-jährige Johann Adam Reinecken. Eine zweite Reise führte ihn - ebenfalls zu Fuß - nach Celle. Immerhin war auch das fast 100 Kilometer entfernt, als Bach am Hofe des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg weltliche und festlich beschwingte Suiten französischer Komponisten und ihre Ballette und auch Opern kennenlernte. Natürlich verschloss Bach sich auch dieser Art der Musik nicht und studierte, was er hörte: Sarabanden, Gavotten und Menuette. Und wieder einmal schrieb er heftig mit und ab ... die Klavierstücke des François Couperin und die Kompositionen vieler anderer französischer Meister. Lernen wollte er ... und diese Werke studieren.
5
Zurück nach Thüringen
Eine kurze Zeit schien es fast so, als ob sich Johann Sebastian Bach ganz für die weltliche, also nicht für die kirchliche Musik entschied. Als 17-Jähriger beendete er schließlich die Schule in Lüneburg. Er hatte damit als erster in der Musikerfamilie die Möglichkeit, an einer Universität zu studieren. Er lief zurück, nach Süden, nach Thüringen.
Das war 1702 und man nimmt an, dass er die ersten Wochen nach seiner Zeit in Lüneburg bei seiner großen Schwester in Erfurt wohnte ... oder nochmals beim Bruder in Ohrdruf. Weimar war ein erstes kurzes berufliches Intermezzo auf Johann Sebastians musikalischen Lebensweg. Er folgte dem Ruf des Herzogs Johann Ernst an dessen Hof nach Weimar. Das war im Januar 1703. Herzog Ernst suchte einen Geiger und einen Musiker, der die Bratsche spielen konnte. Und zwar für sein Kammerorchester. Bereits vier Monate später bewarb sich Bach in Arnstadt. So früh schon erkannte der Ausnahmemusiker, dass er seine Kunst und sein Verständnis von vollendeter Musik nur an der Orgel und mit der geistlichen Musik voll entfalten konnte.
6
Arnstadt wird Bachstadt
Das Video Nummer 7 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: ein kurzes Video mit Information. Sehen Sie sich an, wie Arnstadt heute aussieht. Arnstadt ist die erste Bachstadt in einer Reihe von fünf allgemein bekannten Bachstädten, in denen Bach angestellt war. Genauer sind es fünf Städte, in denen Johann Sebastian Bach in seinem Leben wohnte und gleichzeitig einem Beruf nachging. Das sind Arnstadt, Mühlhausen und Weimar in Thüringen. Zwei weitere Städte sind Köthen und Leipzig, Köthen in Sachsen-Anhalt und Leipzig in Sachsen.
Und so bewarb sich Johann Sebastian Bach um das Organistenamt an der Neuen Kirche in Arnstadt. Die hieß damals natürlich noch nicht Bachkirche. Arnstadt war zu Bachs Zeit die Hauptstadt von Schwarzburg-Sondershausen. Noch heute weisen alle Biografien darauf hin, dass die Bereitschaft, einen Achtzehnjährigen in dieses Amt zu berufen, bereits auf die frühe Anerkennung hindeutete. Genau so sehr wie auf Bachs außergewöhnliches Können. Arnstadt war Johann Sebastians erster Wirkungsort zu einem „vollen auskömmlichen Gehalt“, wie es damals hieß. Seine Aufgabe in der Überlieferung: „... die Orgel an allen Kirchtagen gebührend zu traktieren. Und auch ansonsten im Lehren und Wandel sich der Gottesfurcht, Nüchternheit und Verträglichkeit zu befleißigen. Dazu, sich böser Gesellschaften und Abhaltungen vom Berufe gänzlich zu enthalten“. Fleiß und Hingabe sagte man ihm nach. Er waltete dort seines Amtes, ohne den Eindruck einer Überforderung zu hinterlassen.
7
Die Reise von Bach zu Buxtehude.
Johann Sebastian Bach war inzwischen erwachsen. Aber er war immer noch sehr jung, als er in Arnstadt arbeitete. Eines der bedeutendsten Ereignisse in dieser Zeit war seine Reise nach Lübeck. Zu Dieterich Buxtehude, der damals, 78-jährig, Organist an der Marienkirche in Lübeck war. Konzertmeister war Buxtehude und einer der ganz großen Orgelkomponisten. Im Herbst 1705, also als Bach 20 Jahre alt war, bat er um einen vierwöchigen Urlaub. Das Konsortium in Arnstadt genehmigte diesen Urlaub. Allerdings unter der Bedingung, dass Bach für einen fähigen Stellvertreter zu sorgen habe.
Als er das erledigt hatte, begann Bach seine Wanderung. Wieder war es ein langer Weg, den er zu Fuß bewältigte. Von Arnstadt nach Lübeck war dieser Weg noch weiter als der von Ohrdruf nach Lüneburg. Bach wusste also durchaus, wie lange er unterwegs sein würde. Alleine für die Wanderung ... zuerst nach Norden und anschließend wieder nach Süden. Noch heute besteht unter Biografen keine Einigkeit, ob Bach sich sehr wohl bewusst war, dass ihm diese vier Wochen Zeit keinesfalls ausreichen würden. 760 Kilometer waren es hin und zurück. Das im Hebst, also zu einer Zeit, als die Wege wieder schlammiger wurden, die Tage kürzer und das Wetter schlechter. Und doch war Bach sicherlich voller Hochstimmung, den Künstler und Musiker kennenzulernen, von dem er schon einige Werke der Orgel, des Orchesters und der Klavierkunst erfahren hatte.
Eine tiefere Einsicht in die Geheimnisse der Kirchenmusik erhoffte sich Bach durch dieses Zusammentreffen, das eine so lange und beschwerliche Reise rechtfertigte. Und er wurde nicht enttäuscht. Mitte Oktober traf er schließlich in Lübeck ein. Sofort besuchte er Buxtehude, um sich einer ersten Prüfung seiner Orgelspielkunst zu unterziehen. Natürlich erkannte der erfahrene Meister sofort das außergewöhnliche Potenzial des Jüngeren und dessen ganz besondere Begabung. Buxtehude lud Bach darauf hin in sein Haus ein. Er musizierte mit ihm und war begeistert von der Überlegung, dass Bach dessen Amt in Lübeck übernehmen könnte. Mit 78 Jahren endlich an das Ende des Arbeitslebens zu denken, war nur natürlich ... damals war es das erst recht.
Im Herbst jeden Jahres fanden in Lübeck Geistliche Abendmusiken statt. Buxtehude hatte das 1673, also schon lange vor Bachs Geburt, dort eingeführt. Es waren Kirchenkonzerte. Und zwar an den letzten Trinitatis- und den vier Adventssonntagen. Das Ganze mit einem 40-köpfigen Orchester sowie einem großen Chor. In ganz Norddeutschland waren diese Abendmusiken bekannt. Die Marienkirche erstrahlte dazu im Kerzenlicht und sie war zu jeder Veranstaltung von Musikbegeisterten gefüllt. Im Jahre 1705 wurden zwei „extraordinäre“, also zwei besondere, Kompositionen von Buxtehude uraufgeführt. Zwei Ereignisse waren der Anlass: Erster Grund war der Tod Kaiser Leopolds, der zweite die Thronbesteigung Josephs I.
Zwei Werke waren es also in diesem Herbst des Jahres 1705, als auch Bach unter den Zuhörern war: erstens die erwähnte Trauermusik für den eben erst verstorbenen Kaiser. Der war ein besonderer Freund und Förderer anspruchsvoller Musik gewesen. Die zweite Komposition war eine Begrüßungsmusik für den neuen Kaiser. Bei Bach hinterließen diese Veranstaltungen, ja eigentlich die ganze Zeit in Lübeck, einen tiefen Eindruck. Das Zusammentreffen wird noch heute als die Grundlage für Bachs eigene Meisterschaft gewertet. Über diese so heftigen Eindrücke vergaß Bach dann einfach den Aufbruch zum Rückweg. Oder - wir wissen es eben nicht - er wollte einfach mehr und länger von dieser einzigartigen Kunst seines Vorbildes erlernen.
In dieser Zeit verstrich die Urlaubsfrist zu Hause ... in Arnstadt. Und beinahe - ganz vielleicht - wäre Johann Sebastian Bach auch nie nach Arnstadt zurückgekehrt. Denn beruflich und auch künstlerisch war die Position in Lübeck schon etwas Besonderes. Die Nachfolge Buxtehudes anzutreten, war es ohnehin. Doch es gab eine „Hürde“, die mit Musik überhaupt nichts zu tun hatte: eine erste Hürde, ähnlich einer weiteren - anderer Natur - die Bachs Leben zweimal ganz wesentlich beeinflusst hatte.
Es war zu dieser Zeit üblich, dass der neue Organist die Tochter des Amtsinhabers „zu freien habe“ ... heißt, sie hätte heiraten sollen. Da Buxtehudes Tochter allerdings ganze zehn Jahre älter gewesen war als Bach, und sicherlich auch aus weiteren Gründen, konnte sich Bach, trotz allen Respekts dem Meisterkomponisten Buxtehude gegenüber, dies dann doch nicht vorstellen. Interessanterweise hatten auch andere Meister, ganz besonders zu nennen ist der im gleichen Jahr wie Bach geborene Georg Friedrich Händel, diese Voraussetzung davon abgehalten, sich um die Position des Organisten an der Marienkirche in Lübeck zu bewerben.
8
Die frembde Jungfer
Ende Februar 1706 kam Bach schließlich wieder nach Arnstadt zurück. Aus den vier Wochen Urlaub waren viele Wochen mehr geworden. Aber Bach hatte Glück: Das Arnstädter Konsortium erteilte nur eine Rüge wegen Urlaubsüberschreitung und beließ es dabei. Vielleicht erkannte das Gremium, welchen Könner man für das liebliche Arnstadt verpflichtet hatte.
In der Zeit seiner Abwesenheit hatte sein Vetter Johann Ernst Bach ja die Orgel „traktiert“. Zwischen dem jungen Bach und dem Rat sollte es nicht bei dieser Rüge bleiben. Neue Beschwerden kamen auf, die man heute auch im Zusammenhang mit der Erfahrung in Lübeck sieht. „Neue Klänge entlockte der Komponist der Orgel: Klänge, wie er sie in Lübeck gehört habe ...“ sagte man in Thüringen. Diese neuen Klänge ... sie missfielen den Kirchgängern. Und zu lang waren sie dem Kirchenpublikum auch. Als sich der Superintendent über ein - dessen Ansicht nach - viel zu langes Choralvorspiel beklagte, fühlte sich Bach provoziert und verfiel ins Gegenteil. Natürlich kaum zur Freude aller Beteiligten, präludierte er nun ... zu kurz.
Und es passierte, was noch heute erahnen lässt, wie ungeheuerlich es damals gewesen sein musste: Er erregte regelrechten Anstoß und Ärgernis, als er eine Frau auf der Orgelempore singen ließ. Sie ist als die „frembde Jungfer“ in die Bach-Geschichte eingegangen. Keinesfalls wollte Bach sich schriftlich, wie verlangt, zu diesem Vorwurf äußern. Keinesfalls wollte er außerdem nachgeben: bis hin zu der Möglichkeit, die Anstellung zu verlieren. Was man sicherlich damals an offizieller Stelle noch nicht wusste: Bach hatte sich zu dieser Zeit bereits um die Organistenstelle an der St. Blasiuskirche im nahen Mühlhausen beworben.
Ob diese „frembde Jungfer“ damals Maria Barbara Bach war, die mit ihrem Gesang den Meister auf der Orgel begleitete, ist letztlich nicht sicher bekannt. Auch nicht, wann genau Johann Sebastian seine spätere Frau kennengelernt hatte. Dazu auch nicht, wo und bei welcher Gelegenheit. Möglich war das allerdings bei einem der zahlreichen Familienfeste der Bachs, die jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfanden..
Maria Barbara Bach war Tochter des Oheims Johann Michael Bach, der in Gehren Organist war: Gehren ... 25 Kilometer von Arnstadt entfernt. Sie war dessen jüngste Tochter und Johann Michael Bach war in Gehren ein angesehener Musiker und Komponist. Zwanzig Jahre war Maria Barbara alt, als Johann Sebastian Bach sie als 22-Jähriger heiratete. Das ... in seiner Zeit in Mühlhausen. Am 17. Oktober 1707. Die Hochzeit fand allerdings weder in Mühlhausen noch in Arnstadt statt, sondern in der kleinen Gemeinde Dornheim ganz in der Nähe von Arnstadt. Getraut wurden beide von einem mit Bach befreundeten Pfarrer..
9
Johann Sebastian Bach in Mühlhausen..
Das Video Nummer 8 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine winzige Präsentation mit Information. Sehen Sie sich an, wie Mühlhausen heute aussieht. Zwar ist Johann Sebastian Bach nur relativ kurze Zeit in der Bachstadt Mühlhausen gewesen, schrieb dort aber sein erstes der heute sehr bekannten Werke. Es ist die Ratswechselkantate „Gott ist mein König“. Bach und Mühlhausen trennten sich ohne Groll.
Die Freie Reichsstadt Mühlhausen, die auch Hansestadt ist, war die erste gemeinsame Heimat für das jung vermählte Ehepaar Bach. Die Stadt der Türme und Tore, die Stadt mit zwei gewaltigen, beeindruckenden Kirchen, neben vielen weiteren. Fast selbstverständlich beflügelte seine Heirat mit Maria Barbara Johann Sebastian, konnte er doch davon ausgehen, dass sie all' sein Schaffen, seine Ideen und seine Ideale auch in musikalischer Hinsicht teilte. Musikalisch hochbegabt, so beschrieben Biografen Maria Barbaras Verhältnis zur Musik. Bach hatte seine Fähigkeiten inzwischen weiter vertieft und verfeinert und entwarf inzwischen auch Pläne zur Verbesserung der Orgel. Er ließ ein neuartiges Pedal-Glockenspiel anbringen. Und mit viel Detailarbeit optimierte er die Leistungsfähigkeit von Chor und Orchester in Mühlhausen..
In dieser Zeit entstand auch eines der wenigen im Druck erschienenen Werke Bachs. Es ist seine Kantate „Gott ist mein König“. Anlass für die Komposition war die erste feierliche Einführung des neu gewählten Rates der Stadt Mühlhausen, mit ihm als Organisten an Divi-Blasii. Diese Kantate kennt man auch unter dem Namen Ratswechselkantate. Bach schrieb sogar dann noch zwei weitere Kantaten für den Rat von Mülhausen, als er dort schon gar nicht mehr angestellt war.
Zwei gegensätzliche Richtungen innerhalb der Kirche rivalisierten in dieser Zeit heftigst miteinander. Bachs Musizieren und Komponieren waren davon sehr beeinträchtigt. Nicht nur in Mühlhausen fanden diese Kämpfe und Rangeleien damals statt, sondern in vielen Städten. Der neu aufkommende Pietismus suchte das Glaubensleben zu verinnerlichen; durch Sündenerkenntnis und Besinnung auf den stets „himmlischen Bräutigam“ sollte das Gemüt des Einzelmenschen sich läutern ...“, äußerte sich Christian Jenssen zu diesem Disput. „Das strenggläubige Luthertum hielt allerdings an der Auffassung fest, dass das Heil der Seele einzig von Gottes Gnade abhängt“. Kaum vorstellbar ist heute die Heftigkeit der sich bekriegenden Glaubensrichtungen in der Bevölkerung..
Anzeige
Nirgendwo sonst gibt es so viele „J.S. Bach-Geschenkideen“ wie bei „Bach 4 You“..
... und nirgendwo gibt es auch so viele verschiedene Bach-Figuren wie dort. Alle Bach-Büsten haben einen beeindruckenden Gesichtsausdruck. Hier geht's zum Verlag und von dort geht's dann weiter zum Verlags-Shop. Alle Musik-Kalender sind in drei Größen erhältlich und das dieses Jahr ... sowie nächstes Jahr.
„Bach 4 You“ ist der Bach-Siegel-T-Shirt-Spezialist.
Ende der Anzeige
10
Johann Sebastian Bach heiratet
Das Video Nummer 9 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Dornheim heute aussieht. Dornheim ist der Bachort, den man mit einem Besuch in Arnstadt quasi gratis hinzubekommt. Nur ganze zwei Autominuten entfernt ... somit ist der Besuch dort nicht nur ein Muss für jeden Bach-Fan, sondern auch ein herrlicher Platz, dem Meister „zu begegnen“.
Obwohl Bach einige Jahre in Arnstadt gewohnt und auch in Mühlhausen beste Verbindungen zu den jeweiligen Kirchen und den Pfarrern dort hatte, zog er es vor, sich von seinem Freund, dem Pfarrer der kleinen Dorfkirche in Dornheim trauen zu lassen.
11
Johann Sebastian Bach in Weimar..
Das Video Nummer 10 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: ein kleines Video mit Information. Sehen Sie sich an, wie Weimar heute aussieht. Zweimal in seiner Laufbahn als herausragender Musiker war Johann Sebastian Bach in Weimar. Trotzdem ist Weimar heute die einzige bedeutende Bachstadt ohne ein Bachhaus oder eine ähnliche bedeutende Einrichtung.
Bach stritt sich nicht ... in Mühlhausen. Er hielt sich raus. Seine Kunst, die Musik, war für ihn von weit größerer, höherer Bedeutung als diese Auseinandersetzungen in Mühlhausen. Aber er konnte sich den Querelen natürlich auch nicht komplett entziehen. Und natürlich behinderten sie sein Schaffen und sein Musizieren. Und so kam es, dass er im Jahre 1708 einem Ruf nach Weimar folgte. Dem Ruf des Herzogs Wilhelm Ernst. Herzog Wilhelm Ernst war Kunstfreund ... darüber hinaus führte er seinen Hof fast bürgerlich schlicht.
Das war die richtige Umgebung für einen jungen und idealistischen Musiker wie Johann Sebastian Bach. Nicht nur das Vertrauen des Fürsten förderte dort sein Schaffen. Auch schloss er verschiedene Freundschaften. Männer wie der Bibliothekar Salomon Franck, der Dichter Johann Christoph Lorber und auch der Theologe Erdmann Neumeister inspirierten ihn und hoben sein Schaffen in eine nächste Ebene. Neumeister war es, der ihm als Verfasser von vielen Kantatentexten unentbehrlich wurde. Vielseitig waren für Bach die Möglichkeiten bei Herzog Wilhelm Ernst, war er doch gleichzeitig Hoforganist und auch Kammermusiker. Das war die ideale Basis für Bachs künstlerische Weiterentwicklung. Ganze neun Jahre waren eine ungeheuer produktive Zeit, in der Bach als Orgelspieler und als Orgelkomponist Großes vollbrachte. Dazu beeindruckte er auch mit der Geige und auf dem Cembalo. Man beschrieb seine Fähigkeit „... als Schöpfer neuartiger Orgelkantaten, die durch einen dramatisch vertieften, von der Oper befruchteten, aber nicht verweltlichten, sondern lebendig vergeistigten Gesangsstil die Kantaten seiner Vorgänger in den Schatten stellten“..
„Ich habe von dem berühmten Organisten in Weimar, Herrn Johann Sebastian Bach, Sachen gesehen, sowohl für die Kirche als auch für die Faust, die gewiss so beschaffen sind, dass man den Mann hoch wertschätzen muss.“ Das schrieb, über Bachs Weimarer Zeit, ein hoch angesehener Kunstrichter, der „sehr angesehene Hamburger Musikschriftsteller und Komponist Johann Mattheson“..
Bach war demnach bereits in seiner Zeit in Weimar nicht nur als hervorragender Organist und Klavierspieler bekannt, sondern von einigen Wenigen auch bereits als Komponist sehr beachtet. Viele Kantaten entstanden in Bachs Weimarer Zeit. Die bekanntesten sind Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Wachet, betet, seid bereit, Ich hatte viel Bekümmernis, Himmelskönig sei willkommen, Der Himmel lacht, die Erde jubiliert und schließlich Ein' feste Burg ist unser Gott, die Bach zum 200. Jahrestag der Reformation komponierte. Aber auch weltliche Kantaten wurden in dieser Periode zum ersten Mal uraufgeführt: zu den vielen verschiedenen Feiern am Weimarer Hof. Auch Orgelwerke entstanden zwischen 1708 und 1717: Präludien, Tokkaten, Fugen, Choralchöre. Dazu eine Sammlung von Orgelchoralstücken, die praktisch ein Lehrbuch für zukünftige Organisten waren. Bachs eigene Handschrift überlieferte: „Dem höchsten Gott zu Ehren, dem Nächsten, draus sich zu belehren“.
Anzeige
Wer Bach liebt, den werden die fünf Bach-Shops sehr wahrscheinlich auch begeistern
Alles Mögliche rund um das Thema Johann Sebastian Bach ... das finden Sie im Verlags-Shop. Musik-Kalender gibt es in drei Größen sowie dieses Jahr und nächstes Jahr. Drei Sorten Bach-Bierkrüge gibt es inzwischen: zwei historische und dutzende neue, individuelle.
Hier hinzu bietet der Verlag unzählige Geschenkideen an, die Sie zu einem Musikgeschenk machen können. Mit den vielen Designs zum Thema „Bach“ und „Musik“. Hier geht's ganz fix hin.
Ende der Anzeige
12
Johann Sebastian Bach wird Vater
In Weimar erblickten auch Bachs erste Kinder die Welt: 1708 Catharina Dorothea und zwei Jahre später Wilhelm Friedemann Bach. Johann Christoph Bach, der im Jahr 1713 geboren war, überlebte den Jahreswechsel nicht. Ebenso starb auch dessen Zwillingsschwester Maria Sophia. Im Jahr darauf, 1714, erblickte Carl Philipp Emanuel Bach das Licht der Welt. Und schließlich, im Jahr 1715, Johann Gottfried Bernhard Bach.
Von Weimar aus unternahm Bach erfolgreiche und für ihn sehr anregende Konzertreisen. Zu den wichtigsten Zielen zählten Halle, Leipzig, Meiningen, Kassel und Dresden. In Kassel hörte der Erbprinz Friedrich von Hessen beeindruckt seine Werke und schenkte ihm vor lauter Begeisterung über sein Spiel an der Orgel einen sehr kostbaren Ring, den er sogar vom eigenen Finger nahm. „Seine Füße flogen über die Pedale ...“, so äußert er sich damals zu Bachs Spiel, „... als ob sie Schwingen hätten; Donnergleich brausten die mächtigen Klänge durch die Kirche“. Und genau so beeindruckend, wenn auch nicht so laut, musste ebenso Bachs Spiel auf dem Cembalo, einer damaligen Vorform des Klaviers, angemutet haben.
1717 war ein besonderes Jahr in der Bach-Geschichte. Ein Jahr, in dem sich der gefeierte Orgel- und Klaviervirtuose Jean Louis Marchand aus Frankreich und der Komponist aus Thüringen in einem Wettstreit messen wollten. Jean Louis Marchand war ein Mann voller Temperament. Was ihm zum Nachteil gereichte, denn nach einem Aufsehen erregenden Vorfall am Hofe Ludwigs XIV in Versailles musste Marchand zu August dem Starken von Sachsen fliehen. Drama und Anlass: Marchand hatte sich von seiner Frau getrennt. Daraufhin war von der Königlichen Kammer die Order ergangen, die Hälfte von Marchands Salär an dessen ehemalige Gattin auszubezahlen. Aus genau diesem Grund brach Marchand, anlässlich eines großen, pompösen Konzerts zu Versailles, in der Mitte des Konzerts die Vorstellung ab ... und erklärte dem König sowie dem Publikum: „Wenn meine Frau die Hälfte meines Gehaltes bekommt, dann soll sie auch die Hälfte meines Orgelspiels übernehmen!“ Niemand fand das in Versailles besonders lustig und so kam dann letztlich mit Marchands Aufenthalt in Dresden diese Idee des Musik-Wettstreites zustande: ein Wettbewerb der beiden großen Musiker ihrer Zeit, beide Orgelmeister ... ein wirklich musikalischer Wettstreit.
Heute weiß man nicht mehr mit Sicherheit, von wem die Herausforderung ausging, gepasst hatte es allerdings zum selbstsicheren Franzosen Marchand. Vielleicht aber war es auch einer der Beamten am Hofe des Königs. Bach ging sofort darauf ein, jedes beliebige Stück vom Blatt zu spielen. Oder auch jede nur denkbare musikalische Aufgabe zu lösen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sich auch Marchand zur gleichen Herausforderung bereit zeigte. Marchand war einverstanden und man einigte sich auf einen Schiedsrichter. Den Ort des Wettstreits stellte der sächsische Premierminister Graf Flemming zur Verfügung: dessen eigenes Haus.
Man erwartete ein künstlerisches und gesellschaftliches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung. Allerdings ... wer nicht kam ... war Marchand. Unbemerkt reiste er damals ab. Später hieß es, er habe heimlich Bach beim Üben belauscht und festgestellt, dass er einen Wettstreit gegen diesen Musiker aus Thüringen gar nicht gewinnen hätte können. Bach spielte an diesem Abend für die königliche Gesellschaft. Und er wurde gefeiert. Er wurde gefeiert, wie nie in seinem Leben vorher. Und wie selten nach diesem denkwürdigen Ereignis in Dresden..
13
Johann Sebastian Bach muss ins Gefängnis
In Weimar beachtete man den Triumph von Johann Sebastian Bach in Dresden nicht. Im Gegenteil. Es war genau in dieser Zeit, als der bisherige Musikdirektor Drese in Weimar starb. Bach hatte Drese schon seit längerer Zeit einen sehr großen Teil von dessen Pflichten abgenommen. Nun, als eigentlich die Zeit gekommen war, dass Johann Sebastian Bach dessen Nachfolge antrat, wurde der unbedeutende Sohn Dreses bevorzugt.
Natürlich entging Bach nicht nur die Anerkennung und auch der Titel, sondern natürlich dazu auch die höheren Bezüge. Denn selbstverständlich war das Amt besser dotiert als seine derzeitige Position. Bach war verärgert. Und mit diesem Ärger nahm Johann Sebastian Bach das Angebot einer Kapellmeisterstelle an. Allerdings in Köthen. Fürst Leopold von Anhalt-Köthen machte ihm diesen anerkennenden Vorschlag. Und die Zeit war ebenfalls reif für eine weitere, berufliche Veränderung Bachs. Um in Köthen leben und arbeiten zu können, brauchte Bach jedoch eine förmliche Erlaubnis, gehen zu dürfen. Er war Leibeigener, er war kein Angestellter. Er musste darum bitten, aus den Diensten des Herzogs entlassen zu werden.
Bach beantragte diese Erlaubnis erst nach seiner Zusage in Köthen. Also nachträglich. Aber Herzog Wilhelm Ernst antwortete ihm nicht. Das war für Bach eine ungeheure Belastung und die beiden Männer, die ganze neun Jahre in bestem Einvernehmen ausgekommen waren, gerieten heftigst ... aber nicht von Angesicht zu Angesicht ... aneinander. Fazit: Bach wurde, nachdem er sich gegenüber Kollegen aufgebracht geäußert hatte „... wegen halsstarriger Bezeugung von zu erzwingender Dimission“ vier Wochen lang in Haft genommen. Und darüber hinaus in Ungnaden entlassen. Für Herzog Wilhelm Ernst war das ein Weg, in die Geschichte einzugehen. Noch dreihundert Jahre später und sicherlich bis in alle Zukunft war, ist und bleibt er der Herzog, der den großartigsten Komponisten und Musiker der Erde ins Gefängnis schickte.
14
Köthen ... Paradies und tiefster Abgrund..
Das Video Nummer 11 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: eine kleine Show mit Information. Sehen Sie sich an, wie Köthen heute aussieht. Die Bachstadt Köthen konnte sich Johann Sebastian Bach als Wohnort bis zum Ende seiner Tage gut vorstellen. Aber alles kam anders. In Köthen erlebte Bach seine glücklichste Zeit und auch seine schwersten Tage.
Viele glückliche Jahre verlebte Johann Sebastian Bach mit Maria Barbara und seinen Kindern in der Residenzstadt Köthen. Bach genoss diese Arbeitsstelle und er genoss auch diese schöne Stadt ganz bewusst. Er äußerte mehrfach, sich durchaus genau hier bis zu seinem Lebensende leben und wirken zu sehen. Bach formulierte das sogar als Wunsch.
Eine gewisse Einschränkung vermutet man bei der Begeisterung Bachs für diese Stadt allerdings in der Tatsache, dass er in der Köthener Zeit hauptsächlich weltliche Werke komponierte. Was er ganz sicher am meisten vermisste, war das Spiel auf einer Orgel. Eine Orgel stand ihm in Köthen nämlich nur sehr selten zur Verfügung. In den Vordergrund traten für eine lange Zeit Geige, Bratsche und Klavier. Sicherlich, heiter und freier ließ sich weltliche Musik durchaus komponieren und musizieren. Ob dieser Teil seines Anspruchs allerdings unbefriedigend war, darf durchaus angenommen werden. Die Nachwelt verdankt dieser Situation allerdings herausragende, kostbare Werke der Klavier-, Kammer- und Orchestermusik. Ganz besonders zu erwähnen ist Das Wohltemperierte Klavier, eine Sammlung von Präludien und Fugen in sämtlichen Dur- und Moll-Tonarten.
15
Der Tod von Maria Barbara Bach
400 Taler verdiente Johann Sebastian Bach inzwischen im Jahr. Seine Stellung als Kapellmeister im Dienste des Fürsten in Köthen war hoch angesehen. Warmherzig war Fürst Leopold und so entwickelte sich zwischen den beiden Männern eine Freundschaft, die von beiden Seiten ausging. Es gab zwischen ihnen keinen Standesdünkel, da auch die Großmutter des Fürsten eine Bürgerliche war und Leopolds Mutter dem Landadel entstammte. Als Bach mit zweiunddreißig Jahren nach Köthen kam, war Fürst Leopold erst dreiundzwanzig. Er hatte in seinem Leben aber bereits viele Reisen unternommen und war in vielen Bereichen bereits hochgebildet. Der Fürst hatte Freude an der Musik. Sowohl, sie anzuhören, als auch selber zu musizieren. Perücken verschmähte er, entgegen den Gepflogenheiten zu dieser Zeit. Ungewöhnlich war auch, dass er an seinem relativ kleinen Hof nicht nur eine Kapelle von immerhin achtzehn hervorragenden Musikern unterhielt, sondern auch ein Theater eingerichtet hatte. Und er unternahm kaum eine Reise, ohne dass ihn sein Kapellmeister Johann Sebastian Bach begleitete.
Nach einer solchen Reise mit dem Fürsten passierte dann das Schreckliche. Es war der Sommer im Jahre 1720. Bei seiner Rückkehr musste Bach die schreckliche Nachricht vernehmen, dass, nur wenige Tage zuvor, seine geliebte Maria Barbara verstorben war. Schlimmer noch: Hinzu kam, dass man sie ohne seine Anwesenheit bereits beerdigt hatte. Nicht bekannt ist, welcher Krankheit Maria Barbara im Sommer dieses Schicksalsjahres 1720 so plötzlich erlegen war. Beeindruckt von dieser Katastrophe äußerte Bach seine Gefühle in einem seiner Musikstücke. So erfährt die Welt noch heute von seiner damaligen Niedergeschlagenheit: „Wer sich selbst erhöhet, soll erniedrigt werden.“ Weit über ein Jahr lang trauerte Johann Sebastian um seine Frau ... heiratete dann aber doch zum zweiten Male. Die 20 Jahre alte Hofsängerin Anna Magdalena Wilcke war seine Wahl. Es ist nicht überliefert, ob er nun Anna Magdalena aus Liebe heiratete. Oder „nur“, um für seine Kinder und den Haushalt die nötige Unterstützung zu bekommen. Verschiedenes deutet allerdings auf die erstere Vermutung hin.
Auch Anna Magdalena Wilcke entstammte einer Musikerfamilie. Ihr Vater, Caspar Wülken, war Hoftrompeter am Sächsisch-Weißenfelsischen Hof gewesen. Anna Magdalena selbst war erfolgreiche Sopranistin am Hofe in Köthen. Und deshalb zahlte ihr der Fürst großzügig das hohe Sängerinnen-Gehalt von 318 Talern weiter. Das waren immerhin runde achtzig Prozent von Bachs Gehalt als Kapellmeister. Mit zwei hohen Gehältern und einer noch relativ kleinen Familie herrschte dementsprechend in Köthen keine finanzielle Not. Ob jetzt ab 1721 wieder Freude und Lebensmut in das Leben der Familie von Johann Sebastian einzog oder ob ihn in Köthen doch noch so vieles an seine erste Frau erinnerte, muss hier offen gelassen werden. Anna Magdalena war von Bachs künstlerischem Wirken beeindruckt. Und sie ließ sich von Johann Sebastian gerne unterrichten. Außerdem war da ihre tiefe Bereitschaft, das Verständnis der Musik von Bach vertiefen zu wollen. 1722 bereits schrieb Johann Sebastian Bach für seine zweite Frau das bekannte Klavierbüchlein vor Anna Maria Bachin.
Es war auch in dieser Zeit in Köthen, als er erste Erfolge seiner Söhne in der Musik erlebte. Was ihn natürlich mit ganz besonderem Stolz erfüllte. Dass er, pädagogisch wertvoll, die Anlagen seiner Söhne zu fördern wusste, beweist noch heute das Klavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach. Der war der älteste der sechs musikalischen Söhne. Das Wohltemperierte Klavier, das auch in der Köthener Zeit entstand, war „... ein Lehrbuch und ein Meisterwerk für alle Meister“, die ihm folgten. Es war eine Art ... täglich Brot für junge Musiker, wie Robert Schumann es später nannte. In dieser Zeit komponierte Bach auch für den Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg. Es waren die sechs Brandenburgischen Konzerte. Bach lernte den Markgrafen während einer Reise mit seinem Fürsten Leopold nach Karlsbad kennen. Die Brandenburgischen Konzerte sind eines von Bachs großartigsten symphonischen Instrumentalwerken.
16
Johann Sebastian Bach reist nach Hamburg
1720 war das Jahr, in dem sich Johann Sebastian Bach zum ersten Mal wieder der Kirchenmusik näherte. Anlass war eine Reise nach Hamburg. Dort lebte der Organist, den Bach bereits aus Lüneburg kannte: Johann Adam Reincken. Inzwischen war der 97 Jahre alt geworden. Ihn suchte Bach auf, um dem seiner Meinung nach fähigsten Orgelspieler und musikverständigem Hörer seine Kunst auf der Orgel in der Katharinenkirche vorzuspielen. Und dazu improvisierte Bach. Er improvisierte zum alten Choral An Wasserflüssen Babylon. Damit hinterließ er bei dem greisen Meister und Organisten Reincken einen tiefen Eindruck. Hatte doch genau dieser Reincken selbst in jüngeren Jahren mit einer Interpretation dieses Chorals die Musikwelt begeistert.
Reincken war gerührt und sagte zu Bach „Ich dachte, diese Kunst sei ausgestorben: Nun, da ich sehe, dass sie in dir noch lebt, kann ich mit Freuden heimgehen.“ Tatsächlich war Reincken wenige Tage nach dieser Zusammenkunft zweier ganz Großer der Musikgeschichte verstorben. Diese scheinbar nun vakante Position war aber bereits zuvor mit einem Nachfolger besetzt worden. Zur gleichen Zeit bewarb sich Bach um eine ebenfalls freigewordene Organistenstelle an der Jakobikirche in Hamburg. Doch dort wurde - bereits das zweite Mal passierte Bach das, wie damals in Weimar - ein unbedeutender Musiker vorgezogen. Das, weil dieser versprach, so wie das damals üblich war, im Falle seiner Ernennung 4.000 Mark (... nicht die viel spätere D-Mark, sondern damals eine lokale Währung) in die Kirchenkasse zu zahlen. Das erzürnte den damaligen Pfarrer an St. Jakobi, Erdmann Neumeister, aufs Höchste. In seiner Weihnachtspredigt äußerte der sich sehr deutlich und unmissverständlich: „Ich glaube ganz gewiss, wenn einer von den bethlehemschen Engeln vom Himmel käme, der göttlich spielt, er wollte Organist zu St. Jakob werden, hätte aber kein Geld, so möchte er nur wieder davonfliegen“.
Doch das Verlangen von Johann Sebastian Bach hin zur Kirchenmusik war wieder erweckt. Und es beanspruchte wohl immer mehr Raum in dessen Gefühlen. Eine zweite für Bach ausgesprochen nachteilige Entwicklung nahm am Hof in Köthen ihren Lauf. Fürst Leopold, sein Freund, heiratete ebenfalls in dieser Zeit. Er heiratet eine Prinzessin. Eine Prinzessin, die keinerlei Interesse an Musik hatte, ja keinen Sinn überhaupt für die Schönen Künste. Und mit diesem Desinteresse und während beide ineinander verliebt waren, schwand auch die Begeisterung des Fürsten für die Musik. Mehr und mehr bedeutete ihm die Freundschaft zu Bach nicht mehr das, was es vor seiner Heirat für beide Männer war. Bach beklagte sich in einem Brief „... sie scheint eine Amusa zu sein, und es will das Ansehen gewinnen, als ob die musikalische Neigung des Fürsten in etwas lau werden will“.
In Köthen erinnerte Johann Sebastian Bach noch jeder Platz, jede Ecke und jeder Mensch an seine glücklichste Zeit mit Maria Barbara. Diese ständigen Erinnerungen machten ihm den Alltag dort schwer. Hinzu kamen zwei weitere gewichtige Gründe, die ihn zum Nachdenken brachten. Alles zusammen führte dazu, dass Bach einem Wechsel seines Arbeitsplatzes und seines Lebensumfeldes zunehmend offener gegenüberstand.
Im Sommer 1722 starb in Leipzig der bekannte Klavierkomponist und Kantor Kuhnau. Bach hörte davon. Kuhnau war Kantor an der schon damals berühmten Thomasschule in Leipzig. So entschloss sich Bach, sicherlich auch wegen der etwas abgekühlten, wenn auch noch guten Freundschaft mit Fürst Leopold, sich mit dem Gedanken an einen Weggang von Köthen nach Leipzig zu befassen. Die Nachfolge Kuhnaus war dafür eine Option. Nicht allerdings, ohne gewisse Bedenken zu haben. Den Ausschlag mag gegeben haben, dass Bach in Leipzig die Ausbildung für seine Kinder, vor allem seiner Söhne, als wesentlich besser einschätze: Denn er würde dort ja der Thomaskantor an der Thomasschule werden. In Leipzig war außerdem die Möglichkeit für die Söhne Bachs gegeben, direkt nach der Schulausbildung an der Universität zu studieren.
Anzeige
Der nächste Geburtstag von Freunden und in der Familie kommt ganz sicher!
... hier finden Sie definitiv ein spannendes Musik- oder Bach-Geschenk. Hin zu den Shops?
Ende der Anzeige
17
27 Jahre Leipzig
Das Video Nummer 12 zur Kurzbiografie über Johann Sebastian Bach: ein kleines Video mit Information. Sehen Sie sich an, wie die Bachstadt Leipzig heute aussieht. Mit kaum einer anderen Stadt verbindet sich der Name Johann Sebastian Bach so sehr. Leipzig hat sich in den letzten dreißig Jahren aufs Heftigste verändert. Leipzig ist wunderschön.
Kompliziert schien es in Leipzig gewesen zu sein. Bereits vor Bachs Zeit. Denn namhafte Musiker lehnten die Nachfolge und Position der vakanten Stelle des Thomaskantors 1722 ab. Bach stellte sich dort vor, und zwar mit der Aufführung einer eignen Kantate. Im Februar 1723 passierte das. Der Rat der Stadt Leipzig ließ sich drei volle Monate Zeit, um schließlich Bach zum Kantor der städtischen Schule zu St. Thomas in Leipzig zu ernennen.
Gleich mehrere berühmte Musiker lehnten vorher eine Verpflichtung in Leipzig ab. Wie ein böses Omen, gleich zu Beginn der Leipziger Epoche, erhält sich bis heute die sinngemäße Äußerung, dass, wenn man schon keinen der Besten verpflichten konnte, man dann eben mit einem mittelmäßigen Musiker zufrieden sein müsse. In Leipzig war der Kantor, neben dem Rektor, der wichtigste Lehrer an dieser Thomasschule. Als Thomaskantor allerdings hatte Johann Sebastian Bach auch die Verantwortung über die vier Hauptkirchen der Stadt Leipzig und viele weitere kleine Gotteshäuser.
Fast selbstverständlich gab es über den Musikunterricht hinaus weitere Verpflichtungen für Bach. Wöchentlich galt es, fünf Latein-Stunden zu unterrichten. Verschlechtert hatte er sich also gegenüber seiner Position in Köthen. Geringer war auch die Stellung gegenüber der des Kapellmeisters in Köthen. Allerdings behielt er seinen Titel als Fürstlich-Köthenschen Kapellmeister bei. Bach hatte lange gezögert, sich in Leipzig verpflichten zu lassen. Was letztlich den Ausschlag gab? Es war sicherlich die schulischen Vorteile: die Tatsache, dass seine Söhne in Leipzig die sicherlich beste Ausbildung genießen würden, die es derzeit innerhalb des Spektrums von Bachs Möglichkeiten gab. Bachs Begeisterung für das Musikspiel in der Kirche und auf einer Orgel mögen ebenfalls einen wesentlichen Anteil zu einer ganz sicherlich damals für Bach schwierigen Entscheidung beigetragen haben. Wenn es so ist, dass Bach seine Berufung auch in der Komposition von Kirchenmusik und dem Spielen zu kirchlichen Anlässen sah, dann mag das ein weiterer Punkt in einer ganzen Reihe von Überlegungen gewesen sein. Sie alle führten ihn schließlich nach Leipzig.
Wenn auch, verglichen mit dem Ansehen eines Kapellmeisters in Köthen, das Amt des Kantors an der Thomasschule in Leipzig ein geringeres gewesen war, so war doch Leipzig wesentlich bedeutender als Köthen. Und die Position des Thomaskantors war innerhalb der Stadtgrenzen die angesehenste.
Die Vorgänger von Bach waren allesamt bekannte und beachtete Musiker gewesen. Alle hatten auf das gesamte Musikwesen der Stadt entscheidend eingewirkt. Nicht zuletzt die gute und lebendige Verbindung zur Universität, ganz besonders zur studentischen Musikvereinigung, dem „Collegium musicum“, trug damit entscheidend zu Bachs Überlegung, wie auch der Entscheidung, bei. Nur seine innere Verbindung zur Kirche war noch enger.
Hauptsächlich wurden Schüler der Thomasschule zur musikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste verpflichtet. Ganze vier Chöre gab es zu dieser Zeit. Und diese sangen zu den verschiedensten Ereignissen an Sonntagen und Feiertagen in den vier wichtigen Leipziger Kirchen. Dazu kam die musikalische Leitung bei Hochzeitsfeiern und Beerdigungen und auch aus diesem Grunde war der Kantor eine über die ganze Stadt bekannte Persönlichkeit. Eine Besonderheit in dieser Zeit war der große Einfluss der Kirche auf die Schule. So ergab es sich, dass Johann Sebastian Bach zwar vom Rat der Stadt berufen worden war, aber das Konsortium den Musiker aus Eisenach bestätigen musste. Und diese Bestätigung wurde nicht sofort und nicht selbstverständlich erteilt. Erst nach einem Examen über seine religiösen Grundsätze, dem sich sogar ein Johann Sebastian Bach unterziehen musste, waren die Bedenken des Konsortiums aus dem Wege geräumt.
18
Der Thomaskantor.
Allerdings waren mit der Anstellung von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor auch Vorteile verbunden, die er besonders schätzte. Alle Pflichten in der Schule und auch der Kirche belasteten ihn nicht so sehr, sodass er noch ausreichend Zeit hatte, um zu komponieren. Mit der Anstellung bekam er auch eine kostenfreie Dienstwohnung: in einem Flügel des Schulgebäudes. Sie war zwar anfangs zu klein für seine ganze Familie, aber durch einen entsprechenden Umbau war dieser Nachteil nur von kurzer Dauer. 700 Taler betrug sein Einkommen zu dieser Zeit. Also 300 Taler mehr als in Köthen.
Allerdings entfiel natürlich das Salär, das Anna Magdalena bisher hinzuverdiente. Rechnet man die Mietfreiheit zu den Bezügen Bachs hinzu, war das ein sehr ordentliches Gehalt. Dazu kamen natürlich weitere Einnahmen, wenn Bach zu den verschiedensten Anlässen spielte. Außerdem gab er auch noch privaten Musikunterricht. Gemessen am wesentlich höheren Lebensstandard allerdings war das Leben „unter dem Strich“ in Leipzig für die Familie Bach aber sehr teuer. So beschrieb es Bach nach einigen Jahren in Leipzig in einem Brief an seinen Schulfreund Georg Erdmann, mit dem er vor vielen Jahren von Ohrdruf nach Lüneburg wanderte und dort die Schulzeit mit ihm verbrachte.
Doch dann waren da eben auch die Schattenseiten, die ihn fast drei Jahrzehnte in Leipzig begleiten sollten. Ob Bach an sie dachte, als er sich nur zögerlich in Leipzig bewarb, weiß man heute nicht mehr. Man kann es vermuten, mehr aber nicht. Einen hervorragenden Ruf, so wie heute, hatte die Thomasschule jedenfalls nicht. Erst mit Bachs Wirken wurde die Thomasschule und natürlich auch der Thomanerchor zu dem, was er heute ist: nämlich weltberühmt. Ausschließlich durch Stiftungen wurde die Thomasschule damals „mehr recht als schlecht“ getragen. Hauptsächlich die Kinder armer Eltern gingen dort zur Schule. Deswegen war die Schule auch auf die Einkünfte aus den Knabenchören angewiesen. Und genau aus diesem Grunde sollten die Jungs bei möglichst vielen verschiedenen Veranstaltungen mitwirken.
Allerdings war die soziale Komponente nur ein Teil des Problems. Hinzu kam, dass einfach zu wenige Schulräume zur Verfügung standen. Mehrere Klassen wurden von verschiedenen Lehrern zeitgleich im selben Zimmer unterrichtet. Unordnung, Unsauberkeit und dementsprechend natürlich auch die Verbreitung von Krankheiten resultierten daraus. Und es gab den Streit und Neid innerhalb des Lehrkörpers und die fehlende Lust zur Pflichterfüllung. Alles resultierte in einer gewissen Zuchtlosigkeit, so hieß es damals. Eigentlich konnte man schon von einer Verwahrlosung reden. So sah es in Leipzig an der Thomasschule aus, als Johann Sebastian Bach dort seinen Dienst begann. Es war das Jahr 1723.
All' diese Umstände beeinträchtigten natürlich auch die Disziplin, die ein solcher Chor zur Leistung benötigte. Diese Leistungsfähigkeit war sogar stark beeinträchtigt. Das, was der Thomanerchor heute in der ganzen Welt repräsentiert - schon bereits der Name, einmal abgesehen von der superben Performance - konnte nicht mit heute verglichen werden. Heute steht der Thomanerchor für höchste musikalische Leistung. Heute zählt man die Thomaskantoren mit dem Zusatz „... der zehnte, der zwölfte, der sechzehnte Thomaskantor nach Bach ...“. Damals war das alles noch anders. Es veränderte sich allerdings mit dem Wirken Bachs.
Die Stimmen der jungen Sänger litten. Es war die Folge nach häufigen Einsätzen der Chöre. Daraus resultierten um sich greifenden Erkältungen nach stundenlangem öffentlichen Singen, um Geld für die Schule zu sammeln. Das wiederum führte natürlich zu einer Vernachlässigung der musikalischen Ausbildung. Besonders negativ wirkte sich das Kurrendesingen aus. Entsprechend einer Jahrhunderte alten Sitte sangen die Leipziger Chöre bei allen festlichen Anlässen. Und das ganz besonders natürlich in der Adventszeit. Dazu marschierten die Schüler von Haus zu Haus. Und sie sangen bei jedem Wetter. Natürlich auch bei Minusgraden, bei Regen, Schnee und Eis ... in Häusern, auf der Straße, in Hauseingängen und auf Treppenstiegen. Alles, um Geld zu sammeln ... um dieses auch – zum Teil – untereinander zu verteilen. Natürlich nutzen sich die Stimmen bei dieser Belastung ab. Das Geld wurde in aller Regel sofort wieder vergeudet. Zu dieser Zeit kam in Deutschland die Oper auf. Und sie übte eine starke Anziehungskraft für diese Schüler aus. Es war eine Verlockung, bei diesen Aufführungen dabei zu sein. Oder sogar mitzuwirken. Und ganz besonders war natürlich der Aspekt, dass dort heitere, weltliche Musik präsentiert wurde. Es war ein Anlass für die Jugendlichen, über die Enge des Internatslebens hinaus in eine Märchenwelt in einem prächtigen Rahmen „einzutauchen“.
19
„Musikdirektor und Kantor“
Es gab also eine ganze Anzahl von Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Johann Sebastian Bach mit diesem Amt als Thomaskantor in Leipzig erwarteten. Ob er sich dessen richtig bewusst war, weiß man heute nicht mehr mit Sicherheit. Denn von Johann Sebastian Bach sind nur sehr vereinzelte Dokumente erhalten, die diese Situation betreffen. Es blieb für ihn eine gewagte Entscheidung für das Ungewisse.
Es war auch der Schritt auf der Karriereleiter eine Stufe hinab. Vom Kapellmeister in Köthen zum Thomaskantor in Leipzig. Geführt fühlte er sich von Gott selbst. Und er sagte sich, dass die Kunst Gottesdienst sei und dass seine Kirchenmusik die höchste Vollendung erreichen würde. Er hatte das Selbstvertrauen und die Geduld, den Thomanerchor nach dem zu formen, was er sich, ähnlich seiner Musik, im Geiste durchaus vorstellen konnte. Selbst wenn dafür ein langer Weg und viel, sehr viel, Geduld nötig waren. Er wollte einfach den Thomanerchor zu einem, zu seinem „Musikinstrument“ gestalten. Er sollte mit der Aufführung seiner Kantaten und seiner Kirchenmusik schließlich das gesamte Musikleben Leipzigs nachhaltig verändern und neu prägen.
Johann Sebastian Bach ging ein Ruf voraus. Und er war sich dessen bewusst. So verstand er tief in seinem Inneren die Position in Leipzig auch nicht als die eines Lehrers. Sondern, er sah sie als die einer Art Städtischen Musikdirektors ... und nicht die Stellung als Lehrer mit gewissen allgemeinen Nebenaufgaben. Zunächst sah er den Schuldienst als „wohl oder übel“ auszuführenden Nebenaspekt. Offensichtlich wurde diese, seine Sicht seiner Anstellung auch aus Schriftstücken, die Bach unterzeichnete. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die hinter deren Namen die Berufsbezeichnung „Kantor“ führten, unterschrieb Johann Sebastian Bach mit „Musikdirektor und Kantor“. Oder auch einfach mit „Musikdirektor“. Nur dann, wenn es sich tatsächlich und ausschließlich um schulische Angelegenheiten handelte, unterschrieb er mit der Amtsbezeichnung „Kantor“. Selbstverständlich fiel dies der Stadtbehörde negativ auf. Und es wurde entsprechend in den Akten vermerkt. Aber, wie bei der Festlegung, welche Lieder im sonntäglichen Gottesdienst gesungen werden sollen, setzte Bach mit seiner Form der Unterschrift seinen Willen durch ... und blieb bei seiner Formulierung.
Ganz allgemein ließ sich Bach in seine Arbeit wenig hineinreden. Er behauptete seine künstlerische Freiheit oft dadurch, dass er den Rat der Stadt und das Konsistorium geschickt gegeneinander ausspielte. Das fiel ihm nicht schwer. Besonders wenn zwischen diesen ohnehin Spannungen bestanden. Hatte Bach Probleme mit dem Rat, beschwerte er sich beim Konsistorium ... und hatte er Probleme mit diesem, dann tat er es in die andere Richtung.
20
Zwei Universen: einerseits Bachs Musik ... andererseits Bachs Alltag
Natürlich ist es keine Überraschung, dass Johann Sebastian Bach bei diesen Widrigkeiten in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Leipzig mit gewaltigen Schwierigkeiten und Anfeindungen zu kämpfen hatte. Trotzdem war es für ihn künstlerisch eine sehr produktive und vor allem kreative Phase. Neben den unzähligen Kantaten entstanden vor allem die beiden großen Passionen ... die Johannes-Passion 1724 und die Matthäus-Passion, die in der Karwoche des Jahres 1727 zum ersten Mal uraufgeführt wurde.
Nebenbei: Nicht mit einem Wort wurde die Uraufführung der Matthäus-Passion, das bedeutendste Werk in der christlichen Musik, in der damaligen Leipziger Tageszeitung erwähnt. Beide Passionen sind unsterbliche Werke des Meisters vom Leiden und Sterben von Jesus Christus. Sie sind in einer großartigen musikalischen Folge von Instrumentalsatz, Sprechgesang, Erhöhung des Sprechgesangs zur Melodie, dem Solo-Gesang, Chorgesang und Choral erschaffen. Dabei reichte diese Art der Darstellung der Leidensgeschichte bis ins Mittelalter zurück. Denn schon früh wollten Menschen die Leidensgeschichte Christi in bildlichen, musikalischen und schauspielerischen Darstellungen zelebrieren. Aus den Gesängen, die im zwölften Jahrhundert innerhalb der Passionsspiele üblich waren, entwickelte sich langsam die musikalische Passion bei den Komponisten vor Bach. Die bedeutendsten dieser Musiker waren Johannes Walter, ein Berater Luthers und Heinrich Schütz.
Die Passionen von Johann Sebastian Bachs sind unvergleichbare Meisterwerke. Aus dem evangelischen Gottesdienst entstammend, sind sie noch heute nicht nur einer Konfession zuzuordnen, sondern der gesamten Christenheit. Zwar entstammen sie dem Barockzeitalter, doch in der Tiefe ihres Wesens sind sie zeitlos. Sie sind die Brücke aus dem Mittelalter zur Musik unserer Tage. Mancher meint, dass die Musik von Bach der Architektur gotischer Dome näher ist, als der von Barockkirchen. Und seine Musik wirkt mit unverminderter Eindringlichkeit auf uns Menschen in der heutigen Welt. Die beiden Passionen von Bach, die Johannes-Passion und auch die Matthäus-Passion, sind dabei so überwältigende Offenbarungen der Kunst wie auch des Glaubens an Gott. Man kann ihre Ausdruckskraft nur mit der Anmutung der größten Dome des Mittelalters vergleichen.
21
Bachs berühmter Brief an Georg Erdmann..
Nachdem das Passionsspiel seit der Reformation verfallen war, und auch in der Bildenden Kunst das Motiv der Leidensgeschichte immer mehr in den Hintergrund trat, sah Johann Sebastian Bach seine höchste Bestimmung darin, in seiner „heiligen Musik“, der „musica sacra“, das Opfer von Golgatha im Bewusstsein der damaligen Gesellschaft aufrecht zu erhalten..
Ein ganz besonderes, bedeutendes Ereignis der abendländischen Kulturgeschichte war es also, als 1727 die Matthäus-Passion uraufgeführt wurde. Dazu, als 1730, anlässlich der Jahrhundertfeier der Augsburger Konfession, gleich drei große Kantaten von Johann Sebastian Bach zum ersten Mal die Ohren des Publikums erfreuten. Einzig ... den Rat der Stadt Leipzig beeindruckten sie keinesfalls. Für diese Magistratsherren war ausschließlich wichtig, wie der Kantor seine Schulstunden abhielt. Und dass der sich nicht zu viele Freiheiten nahm, gleich, welcher Art.
Viele Ereignisse provozierten den Rat und führten sowohl zu Vorwürfen, wie auch zu förmlichen Ermahnungen. So entwickelte sich auch aus der Tatsache, dass Bach sich für die von ihm zu erteilenden Lateinstunden einen Stellvertreter gesucht hatte, dessen Leistungen dem Rat schlichtweg nicht ausreichten, Unmut. Ganz bestimmt kam dieser Stellvertreter Bachs ebenso schwierig mit den undisziplinierten Jugendlichen zurecht. Alles in allem war es eine Situation, die zu Problemen führen musste ... über kurz oder lang.
Die nächsten Schwierigkeiten ergaben sich, als der Rat den Universitätsstudenten Zuwendungen kürzte und zum Teil sogar strich. Das hatte Folgen für das Wirken Bachs, denn er brauchte genau diese Studenten der Universität, um beim Thomanerchor mitzuwirken. Trotz all' dieser Widrigkeiten setzte sich Bach gegen den Rat zur Wehr. Einmal einfach nur stur, hin und wieder aber dazu auch noch schroff. Was wiederum nicht zu mehr, sondern natürlich zu weniger Wohlwollen des Rates führte. Letztlich äußerten sich die Ratsherren, dass „... der Kantor rein gar nichts tue und unverbesserlich inkorrigibel sei ...“ und so verminderten sie sogar die Einkünfte von Johann Sebastian Bach.
Bach war verärgert. Er war sehr verärgert. Und gemessen an der Leistung, wie man sie später anerkannte und heute noch anerkennt, mit Recht. Er erwog tatsächlich, Leipzig zu verlassen! Am 28. Oktober 1730 schrieb er in einem Brief - genauer in seinem berühmten Brief an den Schulfreund Georg Erdmann - vom Kummer, der ihn belastete. Erdmann lebte inzwischen in Danzig und bekleidete dort ein hohes Amt. Johann Sebastian Bach schilderte ihm, mit welchen hohen Hoffnungen er Köthen verlassen hatte, um die Position in Leipzig anzutreten. Und er führte - im Wortlaut - aus: „... Da ich aber nun finde, dass erstens dieser Dienst bei weitem nicht so erklecklich, als man mir beschrieben, zweitens viele Nebeneinkünfte dieser Stellung entgangen, drittens ein sehr teurer Ort und viertens es eine wunderliche und der Musik wenig ergeben Obrigkeit ist, mithin fast in stetem Verdruss, Neid und Verfolgung leben muss, werde ich genötigt sein, mit dem höchsten Beistand mein Glück anderweitig zu suchen“.
Auch, wie es um seine Familie stand, führte Bach in diesem Brief aus. Er schrieb: „... Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und ist meine erste Frau selig in Köthen gestorben. Aus erster Ehe sind am Leben drei Söhne und eine Tochter. Aus zweiter Ehe sind am Leben ein Sohn und zwei Töchter. Mein ältester Sohn ist ein studiosus Juris. Die anderen beiden besuchen noch eine Prima und eine Sekunda. Und die älteste Tochter ist auch noch unverheiratet. Die Kinder anderer Ehe sind noch klein, der erstgeborene Knabe sechs Jahre alt. Insgesamt sind sie geborene Musiker, und ich kann versichern, dass ich schon ein Vokal- und Instrumentalkonzert mit meiner Familie veranstalten kann. Zumal, da meine jetzige Frau gar einen sauberen Sopran singt und auch meine älteste Tochter nicht schlimm einschlägt“.
22
Johann Matthias Gesner, ein Lichtblick
Doch das Blatt und die Zustände schienen sich, genau zu dieser Zeit in Leipzig, zu wenden. Die Zeit mit Rektor Ernesti, mit dem Bach so schwerlich zurechtkam, war zu Ende. Die Thomasschule bekam einen neuen Rektor: Johann Matthias Gesner. Der war nicht nur ein berühmter Klassischer Philologe, sondern auch ein hervorragender Erzieher und Schulleiter. Mit dessen Wirken wurde der Unterricht wieder straffer geführt. Er sorgte für ein Miteinander der Lehrer. Und er straffte ganz allgemein die Disziplin. Er galt als Mann von Weitblick, vor allem aber erkannte er die Genialität von Bach. Denn er hatte ein sehr fein ausgeprägtes Kunstverständnis. Und er war sich über den Gewinn der Thomasschule an Prestige und Anerkennung bewusst. Wenn es denn gelänge, dem Meister, also Johann Sebastian Bach, zur vollen Meisterschaft zu verhelfen. Das war dann auch ein Gewinn: nicht nur für die Thomasschule, sondern für die ganze, bedeutende Musikstadt Leipzig.
Einige Jahre später, als Gesner bereits Universitäts-Professor in Göttingen war, schrieb der über Johann Sebastian Bach: „Ich bin sonst ein großer Verehrer des Altertums. Aber ich glaube, dass mein Freund Bach viele Männer wie Orpheus und zwanzig Sänger wie Arion in sich schließt“. Gesner zeichnete sich durch ein sehr umgängliches Wesen, vollendete Manieren und auch durch ein entschiedenes Auftreten aus. Er erwarb sich so das grenzenlose Vertrauen des Rates. Denn ihm war es gelungen, die meisten Probleme zwischen Rat und Bach aus der Welt zu schaffen. Bach wiederum konnte sich so manche Erleichterung verschaffen. Und so kam es, dass sich nach und nach der Thomaskantor mit seinem Arbeitgeber, dem Rat der Stadt Leipzig, wieder versöhnte.
Anzeige
Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele Bach-Kalender wie bei „Bach 4 You“..
Nirgendwo finden Sie zudem mehr verschiedene Bach-Figuren, Bach-Büsten und Bach-Statuen in einem Verlag ...
... als in den Shops von „Bach 4 You“. Klicken Sie hier und auf der nächsten Seite dann zum spannenden „Bach 4 You“-Shop..
Ende der Anzeige
23
Ernesti ... der Zweite!
Lange allerdings dauerte diese ruhige Zeit nicht. Bereits 1734, also genau vier Jahre, nachdem Bach an seinen Schulfreund Georg Erdmann geschrieben hatte, wurde Johann Matthias Gesner an die Universität nach Göttingen berufen. Er verließ Leipzig. Ausgerechnet wurde wieder ein Mann mit dem Namen Ernesti Rektor. Mit dem ersten Ernesti war der allerdings nicht verwandt: Johann August Ernesti ... alleine der Name war kein gutes Omen. Er war als Rektor nun der direkte Vorgesetzte von Bach. Ernestis Alter: siebenundzwanzig Jahre. Bach war neunundvierzig. Ernesti war ein junger Erwachsener mit jugendlichem Ehrgeiz. Dazu ein Eiferer der Klassischen Altertumswissenschaft. Er war ehrgeizig und wollte aus der Thomasschule eine Musteranstalt machen. Er wollte keine „Bierfiedler“, wie er die musikalisch begabten Thomaner nannte. Sondern er wollte junge Gelehrte heranbilden. Wie auch mit dessen Namensvetter, kamen Bach und „Ernesti 2“ anfangs miteinander zurecht. Es herrschte ein gutes Einvernehmen.
24
Der Präfekten-Streit
Doch bereits sehr bald zeigte sich die grundverschiedene Auffassung der beiden sehr eigenwilligen Männer: in Bezug auf den Wert von Musikerziehung. Rasch kam es zu einer gegenseitigen Abneigung. Selbstverständlich dehnte sich das Thema auf die Zuständigkeiten aus: auf die des Rektors auf der einen Seite. Und die des Thomaskantors auf der anderen. Zu dieser Zeit war es üblich, dass jeder der vier Chöre bei den Gottesdiensten von einem „Präfekten“ geleitet wurde. Präfekten waren reifere, zuverlässige, meist ältere Schüler, die vom Kantor ausgewählt wurden.
Als die Stelle eines der vier Präfekten neu zu besetzen war, forderte der Rektor, Ernesti 2, die Einsetzung eines ihm nahestehenden Schülers. Bach gab zunächst nach, obwohl er, wie Quellen belegen, diesen für einen „liederlichen Hund“ hielt. Außerdem zweifelte er auch an dessen Können. Weil der sich denn auch nicht bewährte, ersetzte ihn Bach kurzerhand durch einen anderen Schüler. Allerdings bestand nun Ernesti seinerseits auf die Wiedereinsetzung des Schülers seiner Wahl. Auf Geheiß des Rektors stellte sich jetzt dieser - trotz Bachs Ablehnung - an das Dirigentenpult. Bach gab keinen Zentimeter nach und jagte den Schüler von der Kirchenempore die Treppe herunter. Jetzt wollte allerdings, aus Angst vor Repressionen des Rektors, auch kein anderer Schüler mehr diese Aufgabe ausführen. So passierte es, dass Johann Sebastian Bach schließlich höchstselbst die Leitung des Gottesdienstes übernahm. Es kam, wie es kommen musste: Ernesti wandte sich an den Rat und gleichzeitig an den Superintendenten. Ernesti bekam Recht. Allerdings hielt Bach sich auch nicht an diese Verfügung und blieb störrisch. „... Es möge kosten, was es wolle!“ ... soll er sich zum Thema geäußert haben. Doch Bach wusste, diese politische Rauferei zu führen. Und er wandte sich an den Sächsischen Kurfürsten und Polnischen König August III. Der beendete daraufhin per Dekret den Streit und entschied. Er gab Bach recht.
1737 war Bach bereits ein Jahr lang zum Königlichen Hof-Komponisten ernannt. Zu verdanken hatte er diese Beförderung und Würdigung seiner Lebensleistung vor allem der Königlichen Kanzlei in Dresden. Zweimal hatte er sich schriftlich um diese Gönnerschaft des Königs beworben. Aus genau diesem Grunde komponierte er dazu auch mehrere Festkantaten für den König. Bereits 1733, also drei Jahre vor seiner Ernennung zum Königlichen Hof-Komponisten, ließ er ihm die Kompositionen überreichen. Dazu kamen die ersten Teile seiner h-Moll-Messe mit einer eigens komponierten, untertänigen Widmung. Bach erhoffte sich mit dem Erfolg von genau diesem Werk, dass es einen besonderen Eindruck auf den katholischen Herrscher machte.
Genau für eben dieses Werk, das größte seiner Chorwerke, hatte sich Bach eine Uraufführung in der Sophienkirche zu Dresden erhofft. Nur war es dazu nie gekommen. Mehr und heftiger noch: Bach selbst hatte eine komplette Aufführung seiner h-Moll-Messe niemals selbst erlebt. Nur einzelne Segmente hatte er, hin und wieder, in den Kirchen in Leipzig singen lassen. In diesem außerordentlichen Werk erklingen lateinische Texte des festlichen Gottesdienstes der katholischen Kirche, wie sie zu einem guten Teil auch damals im evangelischen Gottesdienst noch bewahrt worden waren. So sah Bach sicherlich auch in dieser Chor- und Orchestermesse eine Brücke zwischen den beiden Konfessionen. Angeregt zu dieser Meisterleistung war Bach ganz sicher durch die Messen von Palestrina und anderen italienischen Meistern, die Bach in Dresden gehört und studiert hatte. Und Bachs Gedanken gelten ganz sicher bis in unsere heutige Zeit, in der die h-Moll-Messe in der Kirche wie in Konzertsälen erklingt. Sie wirkt dabei lebendiger als je zuvor. Mit ganzen sechzehn Chören, drei Duetten und sechs Arien stellt sie eines der erhabensten und unerschütterlichsten Zeugnisse des gesamten christlichen Glaubens dar.
25
Geht doch!..
Als schließlich der Sächsische Kurfürst und Polnische König August III. den Streit zwischen dem Kantor und dessen vorgesetzten Rektor entschieden hatte, lebten, unterrichteten und wirkten die beiden Kontrahenten Bach und Ernesti eine ganze Zeit lang ohne weitere Zwischenfälle „nebeneinander her“. Besser: Man ging sich aus dem Wege. Und man versuchte, den Kompromiss zu suchen und sich wenig zu provozieren. Es gab keine erheblichen Zwischenfälle. Wenigstens eine Zeitlang. Bach erfüllte seine Pflichten mit Gelassenheit. Und er arbeitete am Leistungsstand des Thomanerchores.
In seiner Tätigkeit als Lehrer an der Schule sah Bach weniger denn je seine Aufgabe. Mehr und mehr widmete er seine Zeit der Komposition und gleichermaßen dem öffentlichen Musizieren in der Städtischen Musikvereinigung. Auch Konzertreisen gehörten zu seinem Arbeitsjahr. Er reiste nach Dresden, nach Köthen und in weitere Orte in Thüringen: um dort Konzerte zu geben. Und auch eine weitere Begabung konnte Bach in dieser Zeit wieder ausleben: Er konnte seine Fähigkeiten, die er im Orgelbau hatte, nutzen. Vielfach beauftragte man ihn mit Prüfungen und Begutachtungen neuer Orgelbauten.
26
Bach und die Leipziger Bevölkerung
Die Leipziger Bevölkerung liebte Bach. Viele, viele Jahre sah sie in Bach den unumstrittenen Lenker des gesamten Leipziger Musiklebens. Zudem kam kein einziger Musiker mit Rang und Namen in die Stadt Leipzig, ohne Johann Sebastian Bach seine Aufwartung zu machen. Auch Johann Christoph Gottsched, der erfolgreiche und strittige Literaturreformer der Aufklärungszeit, sowie viele Professoren der Leipziger Universitäten zollten ihm Respekt. Das widersprach allen, die der Annahme waren, Bach wäre erst lange nach seinem Tode berühmt gewesen. Natürlich ist die heutige weltweite Dimension der Anerkennung eine andere. Und man muss die Anerkennung unterscheiden, die dem Komponisten Bach galt und die Begeisterung für den Musiker Johann Sebastian Bach. Die Würdigung von Bachs Kompositionen stellte allerdings seine unvergleichliche Kunst als Meister im Orgelspiel und des Klavierspiels nur sehr langsam in den Schatten. Denn natürlich erlebte man Bach zu dessen Lebzeiten mehr als begnadeten Musiker.
Einen Überblick über die gesamte Güte und die Dimension von Bachs Werk hatte die breite Bevölkerung damals natürlich nicht. Bach erreichte, was für ihn wichtig war. Das war zuallererst, das Auskommen für seine Familie zu verdienen. Dazu war ihm schließlich auch das Wirken in seiner Musik, und zwar dem Schaffen neuer Werke wie auch bei einer unbehinderten Ausübung seines öffentlichen Spiels, wichtig. Und Bach wollte die Anerkennung, die ihm zustand: die Würdigung dieses, seines öffentlichen musikalischen Wirkens. Darüber hinaus ... legte er seine Sorgen in Gottes Hand.
Viele schließen daraus, damals wie heute und in den runden 250 Jahren dazwischen, dass Bach überhaupt nicht bewusst gewesen war, von welcher Bedeutung sein Schaffen gewesen ist. Auch war da die Antwort von Bach auf die Frage, wie er sich ein solches Können erkläre: „... Ich habe fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen können“. Sie scheint diese Annahme zu untermauern. Dagegen allerdings spricht, dass Bach mit den anderen Größen dieser Zeit, mit Händel, Telemann, Hasse und weiteren Meistern einen regelmäßigen Gedankenaustausch pflegte. Richtig ist natürlich andererseits, dass er nicht nach äußerlichem Ruhm strebte. Aber sicherlich basiert die Bescheidenheit auch darauf, dass er sein Können und die Vollendung seiner Kunst als Gabe Gottes verstand. Auf seinen Partituren stehen die Zeichen „S.D.G“, beziehungsweise Soli Deo Gloria. In Deutsch übersetzt heißt das Gott allein zur Ehre. Oder er fügte die Buchstaben „J.I.“ beziehungsweise Jesu iuva, also „Jesus hilf“ hinzu. Auch in den Lehrbüchern, die alle seine Schüler lasen, hieß es: „Aller Musik Endursache ist anders nicht als Gottes Ehre und Recreation des Gemüts. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleier“.
Anzeige
60 Musik-Kalender: Orgel-Kalender, Komponisten-Kalender, Bach-Kalender
Bach-Kalender sind Geschenke für Musiker. Drei Größen. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Zum Shop.
1.000.000+ Musikgeschenke?
Bach-Büste, Bach-Statue, Bach-Figur..
Ende der Anzeige
27
Der private Johann Sebastian Bach
Obwohl über den privaten Johann Sebastian Bach kaum etwas bekannt ist - man hat so wenig Kenntnis wie fast von keiner anderen Persönlichkeit ähnlicher Dimension - weiß man doch, dass Bach ein guter Bürger gewesen war. Er war auch ein sogenannter Hausvater und ein gewissenhafter Diener der Fürsten. Immer allerdings bewahrte er sich dabei die innere Unabhängigkeit des Künstlers ... des Musikers. Gottvertrauen begleitete ihn durch die hellen wie auch die dunklen Zeiten seines Lebens. Gelassen soll er gewesen sein. Sicherlich auch hin und wieder aufbrausend, aber sonst mit Geduld und Ruhe. Mancher sagte ihm sogar eine gewisse Portion Humor nach: In wenigen seiner Werke spiegelt sich das wieder. Besondere Zeugnisse dafür sind seine weltlichen Kantaten, von denen allerdings viele nicht mehr erhalten sind. Von manchen sind aber noch die Texte gerettet, die er zum Teil selber verfasste. Da schrieb er über das „erwählte und vergnügte Leipzig“. Und fröhlich bekannte er, wie er sich trotz aller Reibereien doch auch in Leipzig wohlfühlte.
28
Über die Kaffee- und andere Kantaten
Einige Kantaten hatte Bach zu öffentlichen Feiern der Stadt komponiert. Und auch anlässlich von Ehrentagen hervorragender Persönlichkeiten in Leipzig. Oft wurden diese Chöre, Duette und Arien dann in Szenen vorgetragen ... Sängerinnen und Sänger trugen dazu farbenfrohe Kostüme. Die Plätze, an denen diese Spektakel stattfanden, waren an den Ufern der Pleiße, die abends mit Fackeln dazu erleuchtet waren. Geschmückte Boote fuhren auf dem Fluss. Promenaden dienten als Kulisse und es gab lauschige Plätze, die in den Lustgärten von Büschen und Hecken umrahmt waren.
Bachs Jagdkantate, die Namenstagkantate, die Hochzeitskantate und weitere Festtagskantaten sind voller heiterer Lebenslust und leichter Anmut. Fröhliche Bachsche Tanzweisen sind noch im letzten Jahrhundert in den Dörfern rund um Leipzig beliebt gewesen. Diese kleinen, weltlichen Kompositionen verraten auch zwischen ihren Zeilen, dass Bach den kleinen Freuden des Lebens durchaus nicht abgeneigt war. Tabak und Kaffee spielten dabei ganz sicher eine Rolle.
Das kleine, lustige Singspiel Kaffeekantate wurde bis im letzten Jahrhundert auch als Puppenspiel dargestellt. Die Hauptpersonen waren dabei der Vater Schlendrian und die schlaue und drollige Jungfer Liesgen. Man vermutet, dass sich hinter den Figuren Johann Sebastian Bach höchstselbst und dessen Tochter verbarg, die - wen wundert es - ebenso Liesgen hieß. Allerdings ist zum Verständnis nötig zu wissen, dass damals das Kaffee trinken, in Bürgerhäusern, noch recht verpönt war. Und eben Liesgen gerne und heimlich diesen Kaffee braute. Solange, bis es selbst dem wohlwollenden Herrn Vater zu bunt wurde. Er ermahnte sie, dass sie nie einen Mann bekommen würde, wenn sie denn das Kaffeetrinken nicht ließe. Liesgen war listig und versprach, den Kaffeegenuss zu beenden, wenn der Vater ihr im Gegenzug „einen Mann anbringen“ würde. Allerdings, als dieser auf die Freiersuche ging, postulierte sie heimlich: „Kein Freier komm' mir in das Haus, er hab' es mir denn selbst versprochen, dass mir erlaubet möge sein, den Kaffee, wie ich will, zu kochen.“ Liesgen meinte, sie müsse auch kein frisches, begehrenswertes junges Mädchen sein, wenn sie ihr Ziel erreiche. Dieser lustige Vers ist übrigens das Werk von einem Hausfreund Bachs, Henrici. Dieser Henrici nannte sich als Dichter übrigens Picander. Zu Liesgen Bach ein Nachsatz: Sie heiratete später einen begabten Schüler Bachs mit dem Namen Altnikol, der schließlich Organist in Naumburg wurde.
Man meint sogar, mit der spritzigen, gemütvollen, launigen Vertonung der Kaffeekantate einen Blick in das Familienleben der Bache zu erhalten. Neun Kinder verblieben Johann Sebastian Bach. Mit beiden Frauen hatte er zusammen 20. In der zweiten Ehe schenkte ihm Anna Magdalena zu den drei Söhnen und der einen Tochter aus der ersten Ehe drei weitere Söhne und noch eine Tochter. Weitere Kinder waren früh verstorbenen. Dass von sechs Söhnen alle musikalisch waren und vier sogar berühmt wurden, zwei sogar berühmter als der Vater zu seiner Zeit, musste ihn wohl maßlos mit Stolz erfüllt haben.
Wilhelm Friedemann, der älteste Sohn, der 1710 geboren war, wurde zuerst Organist in Dresden. Später dann in Halle. Carl Philipp Emanuel, vier Jahre nach Wilhelm Friedemann geboren, wurde Cembalist an keiner geringeren Stelle als am Hofe Friedrichs des Großen in Potsdam. Später wechselte er nach Hamburg und wurde dort hoch angesehener Kirchenmusikdirektor. Johann Christoph, Sohn von Anna Magdalena und Johann Sebastian Bach, geboren 1732, wurde bereits mit 18 Jahren Kammermusiker und später Kapellmeister in Bückeburg. Und schließlich zeigte sich auch bei Johann Christian schon in sehr jungen Jahren die bachische Begabung. Er wirkte später sogar in Mailand und London. Seine Werke werden von manchen Musikliebhabern als Brücke zwischen dem Werk seines Vaters und dem von Wolfgang Amadeus Mozart bezeichnet.
Neben den vielen Todesfällen - immerhin erlebte Johann Sebastian Bach neben dem Tod seiner ersten Frau den von elf seiner Kinder - machte ihm einer seiner Söhne so großen Kummer, dass es bis in die heutige Zeit überliefert ist. Gottfried Bernhard, ebenfalls ein Musiker, und kein schlechter, wurde bereits mit dreiundzwanzig Jahren Organist in Mühlhausen. Aber er war nicht wie die anderen Mitglieder der Musikerfamilie. Ein lockeres Leben sagte man ihm nach. Und er machte Schulden. Er „trieb sich herum“ und er ließ einmal sogar seinen Vater seine Schulden begleichen. Noch einmal „ganz von vorne anfangen“ wollte er. Als Student in Jena, bevor er plötzlich starb. Woran, ist der Nachwelt nicht bekannt. Bach war bestürzt über diese Entwicklung eines seiner Kinder, waren doch alle anderen wohlgeraten. In seinem verbitterten Brief von 1730 schrieb Johann Sebastian Bach: „Was soll ich sagen oder tun? Da keine Vermehrung, ja, keine liebreiche Vorsorge mehr zureichen will, so muss ich mein Kreuz in Geduld tragen, meinen ungeratenen Sohn aber lediglich göttlicher Barmherzigkeit überlassen, nicht zweifelnd, dieselbe werde mein wehmütiges Flehen erhören und endlich nach ihrem Willen an ihm arbeiten: sodass er lerne erkennen, wie die Belehrung einzig und allein der göttlichen Güte zuzuschreiben“.
Natürlich bereitete ihm sein Sohn Gottfried Heinrich, der 1724 zur Welt kam, noch größere Sorge, war dessen Geist und Gemüt doch getrübt. Man sagte damals, „... Nur zeitweilig fällt ein Lichtstrahl in die Dämmerung seiner armen Seele“. Zu solch einer Zeit allerdings konnte sogar der behinderte Sohn von Bach einem Klavier die Töne entlocken, die das Herz ergreifen. Das war allerdings nie von langer Dauer und sein Gemüt fiel in den „... irren Trübsinn ...“ zurück..
29
Johann Sebastian Bach und Friedrich der Große von Preußen
In den Jahren ab 1740 zog sich Bach mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Kaum spürbar zunächst. Und trotzdem ließ er in seinem Schaffen nicht nach. Weltliche Werke und kirchliche Kompositionen konkurrierten mehr und mehr. Sie vermengten sich und spalteten die Leipziger Bevölkerung, seine Bewunderer sowie seine Kritiker. Man berichtete, dass in kirchlichen Kreisen der weltliche Einschlag von Bachs Musik negativ auffiel. Andere wiederum hatten Probleme mit seiner Religiosität. Sie bemängelten, dass Bachs Religiosität - er predigte zwar nicht, noch eiferte und moralisierte er nicht - aber er verkündete in der Gewissheit des ewigen Lebens in Gott, Frieden und Heiterkeit. Bach entschied sich in diesen Jahren für die Kirche, als eigentlichen Raum für seine Musik: nicht für den immer moderner werdenden Konzertsaal. 1743 schlossen sich hochangesehene Leipziger zur „Konzertgesellschaft“ zusammen. Bach ... fand man auf dieser Liste zunächst nicht: dagegen sechzehn einflussreiche Persönlichkeiten schon. Die Konzerte, die diese Gesellschaft fortan veranstaltete, fanden im Gewandhaus, dem Meßhaus der Tuchhändler statt. Bis zum heutigen Tage sind die Leipziger Gewandhaus-Konzerte ein Höhepunkt im kulturellen Leben der Musikstadt.
1747, also drei Jahre vor seine Tode, erfuhr Johann Sebastian nochmals eine seiner ganz großen Ehrungen. Vielleicht war es sogar die allergrößte in seinem Leben. Wieder wurde ihm Königliche Anerkennung zuteil. Friedrich der Große, der preußische König in Potsdam und Berlin, selbst ein Musiker, genauer ein Flötist und den schönen Künsten zugetan, wollte Johann Sebastian Bach persönlich erleben. Mehrmals ließ er ihn durch seinen Sohn Carl Philipp Emanuel, der zu dieser Zeit im Dienste des Königs am Hof musiziert, einladen. Im Mai 1747 schließlich bestieg Bach die Postkutsche und reiste nach Potsdam. Dort kam er am 7. Mai des Jahre 1747 an. Er stieg in einem Gasthaus ab, gerade rechtzeitig, um sich noch in eine Liste eintragen zu lassen, die dem Regenten die Zahl und die Namen der sich in Potsdam am jeweiligen Tage aufhaltende Persönlichkeiten anzeigte und ihm dazu vorgelegt wurde.
Der diensthabende Offizier überreichte dem König die „Liste der Fremden in Potsdam“, als sich der Regent gerade im Musiksaal des Potsdamer Stadtschlosses befand. Er war umgeben von seinen Kammermusikern, deren Namen Graun, Quantz, Benda und eben auch Carl Philipp Emanuel Bach waren. Dazu von einigen musikinteressierten Offizieren. Immer in der Stunde vor dem Abendessen wurde täglich konzertiert. Der König komponierte sogar. Und just an diesem Abend spielte man dessen Suite. Zum Ende des Spiels sprach keiner, konnte doch niemand vor dem König das Wort ergreifen.
Es war eine seltsame Stimmung, das Licht von den herabhängenden Lüstern war schummrig, der König überflog in dieser Stille die Liste, die man ihm gereicht hatte. Der König lächelte und verkündete: „Meine Herren, der alte Bach ist gekommen"! Selbstverständlich schickte er sofort nach Johann Sebastian Bach. Und bereits nach Ablauf von fünfzehn Minuten wurde Bach zum König geführt. Von der Reise noch erschöpft. Ohne sich frisch gemacht zu haben. Noch im „Reiserock“. Der König lächelte nur und deutete mit einer Geste der Unwichtigkeit an, dass sich Bach nicht entschuldigen müsse. Die anderen Anwesenden begrüßten Bach ehrfurchtsvoll und herzlich. Und auch Carl Philipp Emanuel erfreute sich in diesem Moment angesichts der Tatsache, dass der Beehrte sein Vater war.
Wie nicht anders zu erwarten, spielte Bach, wie nur er Musik machen konnte. Im Laufe des Abends entwickelte er am Klavier aus einem vom König ausgedachten Thema eine wunderschöne Fuge. Später entsprach er dem Wunsch des Regenten und spielte eine sechsstimmige Fuge zu einem Thema der Eingebung seiner Majestät just in jenem Augenblick. Und König Friedrich bewunderte Bach. Er stand hinter dem Thomaskantor am Klavier und rief schließlich zu den Umstehenden aus: „Nur ein Bach! Nur ein Bach! Nur ein Bach!“.
30
Wieder in Leipzig
Als Bach nach Leipzig zurückgekehrt war, komponierte er sofort für den König. Es war ein kostbares Variationenwerk, das Musikalische Opfer. In ihm setzte er das Thema, das ihm der König am Tage seines Eintreffens in Potsdam angegeben hatte, um. Zum Teil für Klavier, zum Teil für Streichinstrumente und auch für die Flöte. Bach führte es in dreizehn verschiedenen Arten aus. Zum Beispiel als Fuge, als Kanon, als Sonate und mehr. Das Werk widmete Bach sogar dem König. Und aus dieser Schöpfung erwuchs dann die hohe Kunst der Fuge, in dem jeder Satz „... vor Gott als untadelig bestehen sollte“.
31
Die Jahre 1749 bis 1750
1749 wurde Bach krank und bis heute rätselt die Wissenschaft, was Auslöser für Bachs Augenprobleme gewesen war. Ein Schlaganfall oder Diabetes. Oder beides gleichzeitig. Vierundsechzig Jahre alt war Bach inzwischen: als die Beeinträchtigung, nicht mehr sehen zu können, ihn besonders behinderte. Zu dieser Zeit war ein berühmter englischer Augenarzt auf seiner Reise in Leipzig. Es war das Frühjahr 1750, als John Taylor Johann Sebastian Bach operierte. Nicht einmal, sondern zweimal. Erfolglos. Und trotzdem spielte Bach auch in diesen Wochen - niemand hätte es anders erwartet - blind auf der Orgel der Thomaskirche. In gewaltigen und zarten Improvisationen führte er sein Gespräch mit Gott: ergeben, vertrauend, wartend, geduldig, versunken und in Erinnerung an die großen Stunden seines intensiven Lebens. Nicht einmal mit Komponieren hörte er zu dieser Zeit auf. Seinen Schwiegersohn Altnikol bat er, anzureisen: Der schrieb die Noten nieder, die ihm der Meister diktierte. Auch die Noten zu einem letzten, dann unvollendeten Werk ... mit einem unvollendeten Orgelvorspiel mit dem bezeichnenden Titel Wenn wir in höchsten Nöten sind. Die Ahnung des nahenden Endes wurde Bach bewusst und er bat Altnikol, dem Präludium einen anderen Namen zu geben. Es war und ist heute der Titel Vor Deinen Thron tret' ich hiermit.
32
Johann Sebastian Bach kann wieder sehen
Nur wenige Wochen vor seinem Tode geschah dann das Wunder: Johann Sebastian Bach konnte wieder sehen. Es war wie durch Gottes Hand. Er sah die Gesichter seiner Familie, seiner Frau und seiner Kinder. Er erlebte den Sommer an diesem Tag. Er sah wieder den blauen Himmel, die weißen Wolken, den Kirchturm, die Sonne ... und seine geliebten Notenblätter. Er spielte Nun danket alle Gott!..
Kurz darauf - auch darüber ist man sich heute nicht einig, ob es denn Entkräftung war, die mit beiden Operationen einherging, oder ob es ein zweiter Schlaganfall war - ging es Bach wieder schlechter und der Körper verzehrte die letzte verbliebene Energie. Zehn Tage lebte er noch. An seinem Sterbebett nahmen Anna Magdalena und seine Tochter Liesgen mit ihrem Mann, der Sohn Johann Christian und ein Schüler von Bach Abschied von einem der Größten der Musikgeschichte. Am Abend des 28. Juli 1750 holte Gott seinen begnadetsten Musiker zu sich.
33
Die ersten Jahre nach Bachs Tod
Zehn Jahre lang überlebte ihn Anna Magdalena in einer für sie harten Zeit. Allerdings lebte Anna Magdalena in dieser Zeit nicht veramt. Nur um gesellschaftlich gleichermaßen weiterleben zu können, musste sie für Einnahmen sorgen. Sie verkaufte kopierte Musikwerke ihres Mannes und auch einige Instruimente. Ein Almosenantrag ist noch heute erhalten, der aber nicht zu dem Schluss führen darf, dass sie arm war. Eine solche Zuwendung stand ihr einfach zu. Sie war üblich zu dieser Zeit. Erst in unseren Tagen fand man heraus, dass Bach auch finanziell an einem Silberbergwerk beteiiligt war. Das allerdings sagt nichts über das Vermögen der Bachs aus. Denn zu dieser Zeit, wie auch heute, konnte es durchaus sein, dass diese Beteiligung ein Zuschussgeschäft war. Während dieser Zeit umsorgte Anna Magdalena natürlich das Grab des Thomaskantors auf einem Leipziger Friedhof. Es lag neben einer Mauer auf dem Alten Johannisfriedhof. Nicht einmal ein Grabstein erinnerte an den Meister. Er wurde dazu ohne jede Ehrung schnell und einfach „verscharrt“.
Später wurde er exhumiert, weil die Kirche erweitert werden sollte und man den Platz für das Fundament dafür brauchte. Die zweite Beisetzung war dann angemessener und die Leipziger Bevölkerung trauerte um den Meister. Bach ruhte schließlich viele Jahre in der „Bach-Gellert-Gruft“ unter der Johanniskirche. Nachdem die Johanniskirche nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde, „zog Bach nochmals um“. Heute liegt er – endlich seinem Rang und seiner Bedeutung entsprechend – ganz prominent zentral in der Thomaskirche, direkt in der Nähe des Altars.
Nach seinem Tod allerdings schwand die Erinnerung an Bach mehr und mehr ... sowohl an seine Person, wie auch an sein Werk. Sicherlich, Musiker erinnerten sich seiner Leistung immer. Die breite Öffentlichkeit allerdings vergaß Bach einfach. Modernere Musik war ab dann gefragt. Robert Schumann suchte in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts das Grab von Johann Sebastian Bach in Leipzig. Niemand wusste, wo es war. Von Schumann erfuhr man: „... Viele Stunden forschte ich auf dem Friedhof kreuz und quer ... ich fand keinen Johann Sebastian Bach. Und als ich den Totengräber fragte, schüttelte der über die Unbekanntheit des Mannes den Kopf: „Bach ... gibt’s viele!“.“.
Bachs künstlerisches Erbe, sein Werk, wurde unter seinen Söhnen verteilt und das Vergessen von Bachs Einzigartigkeit war auch dieser Lebensleistung ärgster Feind. Denn selbst seine eigenen Söhne erkannten dieses unvergleichliche Vermächtnis von Johann Sebastian Bach nicht. Und nicht seine Bedeutung für die Musik und seinen Wert für die Welt. So gingen viele Werke, die ihnen anvertraut wurden, nach und nach verloren. Natürlich waren damals diese Schätze im täglichen Kampf um Geld und Überleben der Unterschied zwischen einem Abendessen und keinem ... aber diese Entwicklung trug eben auch dazu bei, dass praktisch alles Wissen um Bach und dessen Werk in einen „Dornröschenschlaf“ von einem dreiviertel Jahrhundert verlorenging..
Erst der ebenfalls berühmte Musiker Felix Mendelssohn Bartholdy führte 1829, nach dieser unendlich langen Zeit, die Matthäus-Passion wieder auf. In einer etwas einfacheren Version „... damit sie das Volk nicht überlaste“. Das war 102 Jahre nach dem Bach sie uraufgeführt hatte. Auf den Tag genau, nämlich an einem Karfreitag. Seitdem verehrt die Welt den Komponisten Johann Sebastian Bach und erfreut sich auf der ganzen Erde an seiner göttlichen Musik aufs Neue..
Sehr, sehr frei nach Bach-Biograf Felix Adam Kerbel, 1822 bis 1901..
Anzeige
800 Bücher zum Thema Bach: jpc ist der größte Musikalienhändler Europas
Bach-Bücher sind Musiker-Geschenke. Und Bach-Kalender ebenfalls. Kalender gibt's immer in drei Größen. Dieses Jahr und nächstes Jahr. jpc ist der Partnerverlag unserer Bach-Mission. Zum Shop und dort zu den Bach-Büchern.
Bitte unterstützen Sie unsere Bach-Mission
Nochmals geht es hier zu allen fünf „Bach 4 You“-Shops. Mit einem Klick.
Einer der jüngsten Bach-Kalender.
Ende der Anzeige